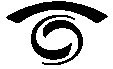Kultur um der Freiheit willen.
Europa und die Griechen
Festrede des Reuchlinpreisträgers 2007, Professor Christian Meier, Historiker,
anlässlich der Reuchlinpreisvergabe am 14.07.2007 in Pforzheim
Rede im vollen Wortlaut: Es gilt das gesprochene Wort!
Der Reuchlinpreis ist – wie die Liste der Preisträger zeigt – eine bedeutende Auszeichnung.
Ich fürchte, ich verdiente sie nicht, betrachte sie daher als ein großes Geschenk und möchte
der Heidelberger Akademie für die Wahl, vor allem aber der Stadt Pforzheim für den Preis herzlich danken. Preisgewohnte Kollegen versichern mir mit leuchtenden Augen, daß der Reuchlinpreis nicht zuletzt durch die Umstände, in die seine Verleihung eingebettet ist, zu
den schönsten gehört.
Ego primus omnium Graeca in Germaniam reduxi. (Als erster von allen habe ich das Griechische
nach Deutschland zurückgeführt). Berechtigter Stolz spricht aus diesem Satz Reuchlins. Man stimmt ihm gern zu. Obwohl man dann stolpert: Wieso zurückgeführt? War das Griechische denn zuvor schon im römischen Germanien zuhause? Bezieht sich Reuchlin hier allgemein auf die römische, also auf die zivilisierte Vergangenheit seiner Heimat? Oder hat er einen Druckfehler übersehen und eigentlich deduxi geschrieben, das Griechische also herabgeführt, von den Alpen nämlich, – wie einst, in einer Wendung,
auf die Reuchlin deutlich anzuspielen scheint, Roms großer Dichter Vergil als erster (primus ego) die Musen in seine Vaterstadt herabführen (deducere) wollte, nämlich vom Berg Helikon, in Böotien, wo
sie lokalisiert waren?
Doch lassen wir die Textkritik! Reuchlin steht jedenfalls am Anfang der Rezeption des Griechischen in Deutschland, jener Berührung, welche bald zu einer innigen Symbiose werden sollte, die aber mittlerweile auf eine Menge Bedenken gestoßen ist. The Tyranny of Greece over Germany lautet der Titel und zugleich die These des Buches von E. M. Butler aus dem Jahre 1935 (in dem es vornehmlich um Kunst und Dichtung geht, nicht ohne freilich daß einem schon der Name Hitler in diesem Zusammenhang unter die Nase gerieben würde).
War das also eine eher zweifelhafte Gabe, welche Reuchlin über die Alpen mitbrachte? Oder war nur die übliche Ambivalenz aller Gaben auch ihr zueigen? Oder haben bloß die Deutschen aus wer weiß welchen Gründen den falschen Gebrauch davon gemacht? Es ist kaum möglich, auf solche Fragen eine wissenschaftlich begründete Antwort zu geben; zumindest für den, der sich nicht in der Lage sieht, die Deutschen in diesem Punkt mit andern europäischen Völkern gründlich zu vergleichen.
Aber man kann das Problem zum Anlaß nehmen, über die Entstehung und Weiterbildung von Kulturen nachzudenken; auf dem Hintergrund der Frage, was die Übernahmen aus andern Kulturen dabei für eine Rolle spielen. Dazu möchte ich Sie hier einladen. Vielleicht interessiert es Sie ja auch, woran Ihr Preisträger seit einigen Jahren arbeitet.
Fast immer knüpfen Kulturen bei ihrer Entstehung an vorangegangene an. Die Griechen selbst bilden dafür ein Beispiel. Denn sie haben unendlich vieles in ihrer frühen Zeit aus dem Orient, von Phöniziern, Ägyptern und andern, übernommen, sich zu vielem auch von dort anregen lassen.
Man kann grob zwei Weisen der Öffnung zu einer vorherigen Kultur unterscheiden. Die eine besteht darin, daß die jüngere sich eine gewisse Zeitlang von der älteren befruchten läßt, sich aber im folgenden um sie nur mehr wenig kümmert. Das war die Weise der Griechen. Und es sollte später, vornehmlich im neunten Jahrhundert n. Chr., die der Araber sein, die sich einen guten Teil der griechischen Überlieferung übersetzen ließen, um damit auf großartige Weise weiterzuarbeiten, ohne sich fortan für die griechischen Quellen noch viel zu interessieren. Sie hatten ihren Dienst getan.
Da wird, wie Rémi Brague das ausgedrückt hat, gleichsam die Frucht ausgesaugt, Schale und Kern dagegen weggeworfen. Kaum ein Araber hat Griechisch gelernt, kaum ein Grieche orientalische Sprachen. Sie waren zumeist auf Übersetzer angewiesen.
Ganz anders – und das ist die zweite Weise – das mittelalterlich/neuzeitliche Europa. Hier wird nicht nur von Römern und Griechen alles übernommen, was man überhaupt nur finden kann, sondern man lernt ihre Sprachen, ediert und studiert ihre Texte, immer wieder, entwickelt Textkritik und Philologie (wie Reuchlins Beispiel zeigt), studiert auch antike Bildhauerkunst und Architektur, um sie sich weithin zum Vorbild zu nehmen. Man läßt sogar seine Kinder (soweit man es kann) noch eineinhalb Jahrtausende nach dem Niedergang der Antike Latein und oft auch Griechisch lernen.
Was bedeutet das? Woher erklärt es sich? Ist es eine besondere Eigenart des mittelalterlich/neuzeitlichen Europa, die hier im Spiel ist? Oder eher eine der Griechen und Römer, welche diesem Europa vielleicht ganz besonders, ja unerschöpflich viel zu sagen gehabt haben?
Von hier also geht meine Frage aus. Was hat es mit dieser griechischen Kultur auf sich? Ich möchte die Herausforderung skizzieren, auf die sie die Antwort war. Und ich möchte an einigen Beispielen zeigen, wie diese Kultur als Antwort auf diese Herausforderung zu verstehen ist. Es handelt sich, schlagwortartig gesagt, um die Herausforderung der Freiheit.
Kulturen sind Weisen, auf die sich Völker in der Welt einrichten. Mit ihrer Umwelt wie mit sich selbst. Wobei es nicht nur um Techniken und um Ordnungen, Formen gesitteten Umgangs und Menschenbildung, sondern auch darum geht, sich in der Welt zurecht- (und zu Recht) zufinden, unter anderem damit sie sich der Annahme fügt, es gehe in ihr mit rechten Dingen zu. Man muß den Dingen Bedeutung geben. Vielerlei Erfahrungen, Ängste und Nöte wollen zu Wort, zu Bild, zu Gestalt gebracht, aber auch das Bedürfnis nach dem Schönen will befriedigt (und gelenkt) werden. Man muß wissen, wer man ist und sein will.
Diese Einrichtung in der Welt ist im wesentlichen bestimmt durch diejenigen, die innerhalb dieser Völker maßgebend sind oder sich als maßgebend erweisen, die, wie es so schön heißt und in diesem Fall buchstäblich zu nehmen ist, das Sagen haben (und prägen). Zumeist sind das, überblickt man die Weltgeschichte, Usurpatoren und Monarchen. Und was sie dabei hervorbringen, dient neben vielen unmittelbaren Zwecken nicht zuletzt der Befestigung ihrer Herrschaft. Minderprivilegierte oder Opponenten haben es dagegen sehr viel schwerer, sich in eine Kultur einzuschreiben. Die israelitischen Propheten stehen für die Ausnahme, nicht für die Regel.
Bei den Griechen aber verhielt sich das anders. Dort war es jeweils eine Mehrheit, zunächst der Adel, in einem späteren Stadium auch breitere Schichten, die bestimmend war und alles auf sich ausrichtete. Und die Kultur, die sie hervorbrachte, war geprägt nicht durch Herrschaft, sondern durch Freiheit. Auch so fern und so lange die Adligen, was gar nicht selten war, das Gros der Bürger eher beherrschten als führten (und viele von ihnen auch ausbeuteten), war ihre Herrschaft eher löchrig. Denn, was Schiller von Don Carlos sagen läßt, galt auch von ihnen: Sie waren „stolz auf ihre Freiheit. Des Zwanges ungewohnt, mit dem man Zwang zu kaufen sich bequemen muß“. Wollten sich nicht im Sinne von Herrschaft disziplinieren, sondern vor allem leben und sich ausleben. Damit öffnete sich ein Einfallstor für den politischen Aufstieg breiter Schichten.
Indes, was heißt da Freiheit? Ich gebrauche das Wort in einem beschreibenden Sinne. Es geht nicht um Freiheitsrechte, wie sie im Kampf mit einem Herrscher oder einem Staat erkämpft werden. Oder um die staatlich gewährten Freiräume, alias Rückzugsgebiete, die wir heute so reichlich genießen. Freiheit meint hier vielmehr eine Eigenschaft der freien Grundeigentümer, welche diese Gemeinwesen bildeten. Sie fußten auf dem Eigentum an Land und Vieh, das es ihnen erlaubte, weitgehend eigenständig, unabhängig zu sein. Und darauf legten sie bemerkenswerter Weise großen Wert. Das aber hieß auch, daß sie weitgehend auf sich gestellt waren, ungebunden, ja relativ bindungsresistent. Womit insgesamt hohe Risiken verknüpft waren, die ja aber zur Freiheit gehören. Freiheit eignete vornehmlich den Männern, kaum den Frauen, gar nicht den Sklaven, auf die Dauer jedoch sehr wohl auch denen, die keinen Grund besaßen, ja den Armen, sofern sie Bürger waren.
Diesen Griechen lag sehr viel daran, in kleinen selbständigen Gemeinwesen zu leben. So haben sie ja auch, als der Raum für die wachsende Bevölkerung zu eng wurde, kaum daran gedacht, ihren Nachbarn Land wegzunehmen, sondern weit in der Ferne neue, wiederum kleine selbständige Gemeinden gegründet. Sie haben überhaupt vergleichsweise sehr wenig Wert darauf gelegt, Eroberungen zu machen oder gar andere in ihren Verband aufzunehmen. Das hätte sich nicht mit dessen Charakter vertragen. So wie sie aufeinander eingespielt waren, mochte das Zusammenleben funktionieren. Es mit andern, die das auf ihre Weise auch waren, zu teilen, war allzu riskant.
Gemeinwesen – das waren sie alle zusammen, ganz konkret und unvermittelt. Die zentralen Instanzen, die sie brauchten, sollten möglichst wenig eigene Macht haben. In voller Körpergröße, so wie sie waren, wollten sie das Ganze des Gemeinwesens selber ausmachen. Das hieß auch: Jeder sollte sich möglichst allseitig ausbilden, für alles befähigt sein. Kein Gedanke an all die Unterordnungen, Spezialisierungen, Abhängigkeiten, die heute dazu tendieren, alles im Staat kleinzumachen, die Einzelnen auf Funktionen zu beschränken und zu instrumentalisieren. Vielleicht kann man sagen: Die Gemeinwesen sollten klein sein, damit die Zugehörigen möglichst groß sein konnten. Und ihre Enge ergänzte sich mit der Weite Griechenlands – und des Mittelmeers – in der viele von ihnen sich frei zu bewegen pflegten.
Das etwa war die Ausgangsposition der griechischen Geschichte im achten Jahrhundert v. Chr. Offen war, ob es bei dieser relativ großen Freiheit bleiben konnte, wenn sich die Polisgesellschaften differenzierten, genauer: große Ungleichheit sich ausprägte. Aus verschiedenen Gründen wurden, zumal in den bewegteren Städten, die einen mit der Zeit sehr viel reicher, andere (und gar nicht wenige) sehr viel ärmer (und litten zum Teil große Not). Die Spielräume weiteten sich. Selbstverständliche Schranken des Handeln und Trachtens wurden niedergelegt. Die Standards und mehr noch die Ansprüche schnellten in die Höhe. Weit taten sich Scheren zwischen Ansprüchen und Mitteln, sie zu befriedigen, auf.
Mit dem Streben nach Reichtum ergab sich das nach Macht, ja nach Herrschaft. Adlige taten sich zusammen, um andere auszustechen. Fehden wurden ausgetragen, Rache geübt. Enteignungen und Verbannungen waren an der Tagesordnung. Tiefe Klüfte zogen sich immer wieder durch zahlreiche Gemeinwesen. Und oft genug war keiner da, der das Interesse des Ganzen an Zusammenhalt, an geregelten Abläufen, Einschränkung von Regelübertretungen, an innerem Frieden und am Walten von Gerechtigkeit hätte wahrnehmen können. Die Amtsträger waren eher Teil des Problems, als daß sie es hätten lösen helfen können. Die Räte waren oft gespalten, Volksversammlungen machtlos oder selbst den Streitenden ausgeliefert. Das Hemd egoistischer, parteilicher und, wie gesagt, häufig auf Herrschaft ausgerichteter Interessen war den meisten Akteuren viel näher als der Rock des Gemeinwesens, welches die Sache von allen und keinem war.
Das alles steigerte sich, als sich zu den Adelsfehden Empörungen der Notleidenden gesellten, ihrerseits voller Gewalt.
Das Ergebnis dieser Kämpfe war vielerorts die Einrichtung einer Monarchie, der sogenannten Tyrannis. Sie vermochte verschiedenen Problemen beizukommen; sicherte Ruhe und Ordnung, möglicherweise auch eine einigermaßen gerechte Rechtsprechung; verhalf dazu, daß sich die wirtschaftliche Lage auch für breitere Kreise konsolidierte.
Rückblickend betrachtet mag es scheinen, als ob die Griechen damals, seit der Mitte des siebten Jahrhunderts, auf den üblichen Weg der Kulturbildung einschwenkten: Die Begründung von Herrschaft, unter deren Schutz, mit deren Hilfe und in deren Rahmen sie ihre weitere Entwicklung hätten besorgen können.
Allein, die Tyrannen vermochten – selbst wenn eine Familie hundert Jahre am Ruder war – ihre Herrschaft nicht Wurzeln schlagen zu lassen. Sie mochten tun und bieten, was sie wollten, es blieb ein Widerspruch zwischen der Herrschaft eines Einzelnen und den in der Polis und deren Bürgern obwaltenden Lebenstendenzen. Das waren nicht Werte (welche so leicht der Umwertung anheimfallen), es waren auch nicht bloß Wünsche, sondern es waren Bestrebungen, die den Gegebenheiten, ihren Lebensformen, ihren Verhältnissen innewohnten, die mit diesen Gegebenheiten verschachtelt waren, folglich stets neu sich erzeugten. Und das nicht nur unter den Adligen. Denn was unter diesen galt, konnten (und mußten vielleicht) sich auch andere, die Angehörigen der Mittelschicht zumal, zu eigen machen. Sie dienten lange schon in den Kriegen, neben den Adligen. Und die Grenzen zwischen Ober- und Mittelschicht waren fließend.
Wenn der Tyrann fand, seine Untertanen sollten sich um ihre eigenen häuslichen Dinge kümmern, die allgemeinen der Stadt werde er selbst besorgen, so verkürzte er ihr Bürger-Sein. Sie waren eben nicht nur Hausherrn. Ihre Vorstellung vom Gemeinwesen war die Vorstellung von sich selbst in ihrer gemeinsamen Gegenwärtigkeit. Die Stadt konnte folglich nicht als Gegenstand der Fürsorge verstanden werden. Wer herrschte, war nicht Sachwalter der Stadt, sondern Herrscher über seinesgleichen. Und diese Herrschaft pflegte mit der Zeit in Willkür auszuarten.
Gewiß, wenn die Not – oder die Herrschaft eines Einzelnen – sie zwang, mußten sie sich beugen. Aber das hieß ja noch nicht, daß sie diese Herrschaft für legitim gehalten hätten. Auch nicht, daß der Tyrann das Ganze auf neue Inhalte und Ziele neu hätte orientieren können, angesichts derer seine Herrschaft sich von selbst hätte verstehen können. Zudem waren die Städte stets eingebettet in eine gemeingriechische Öffentlichkeit, und dort hielt man zumindest weithin an den herkömmlichen, freien Formen des Zusammenlebens fest.
Wie aber wollten die Griechen dann ihr Zusammenleben in den so viel komplizierter gewordenen Poleis organisieren? Ohne starkes politisches Zentrum, bei aller Freiheit und allen Kämpfen, die daraus neuerdings entsprießen mochten?
Die weitere Geschichte zeigt, daß es vielerorts gelang, die bäuerlichen Mittelschichten ins Spiel zu bringen. Sie konnten gleichsam das Gewicht der Mehrheit und damit des Ganzen geltend machen – und dem partikularistischen Treiben der Adelsfaktionen Grenzen oder gar ein Ende setzen. Da gewannen auch sie an Freiheit, was zugleich bedeutete: an Mitsprache, an Rang im Gemeinwesen.
Auf welchen Wegen aber konnte es dazu kommen? Adlige galten als „Führer des Volks“. Sie waren allen andern überlegen an Eigentum, an Bildung, an Beziehungen, an Auftreten. Waren abkömmlich, konnten also regelmäßig anwesend sein auf der Agora, im Zentrum der Stadt. Wie konnten die Bauern überhaupt daran denken, mit ihnen mitzuhalten? Es ging ja, wenn sie eine gewichtige Rolle in der Stadt spielen wollten, nicht darum, daß sie ab und an in der Volksversammlung Beamte wählten oder Gesetze beschlossen. Da mochten sie in diesem oder jenem ihren Willen durchsetzen: In der Regel aber wäre ihnen nichts anderes übrig geblieben, denn als Gefolgsleute der Adligen zu funktionieren. Auch wenn sich einmal ein Adliger zum Anwalt der Interessen von Notleidenden machte, führte es ja im Fall des Erfolgs regelmäßig dazu, daß diese dabei einige wirtschaftliche Vorteile erlangten, er dagegen den politischen Ertrag, die Macht oder die Herrschaft einstrich. Wir wissen von der verbreiteten Neigung vieler Bauern, sich von der Politik fernzuhalten. So kamen in die Volksversammlungen vor allem die, die von der einen oder anderen Adelsgruppe jeweils aufgeboten wurden. Unter diesen Umständen walteten die vertikalen Solidaritäten, Bindungen zwischen Hohen und Niederen, ja Abhängigkeiten der Niederen von den Hohen vor.
Wenn man daran etwas ändern wollte, wenn die bäuerlichen Mittelschichten wirklich etwas zu sagen haben sollten, wenn die adlige Willkür (auch die der adligen Richter) eingeschränkt werden sollte, dann mußten sie eine horizontale Solidarität herstellen, sich also auf ihre gemeinsamen Interessen einschwören. Und die bestanden darin, daß sie sich Respekt verschafften, gegen die im einzelnen immer noch weit überlegenen Adligen. Darin konnten sie sogar einmütig sein. Denn diese Gemeinwesen kannten keine Wirtschafts- und Sozial-, keine Bildungspolitik – all das, was sonst Teile des Volkes gegen andere hätte einnehmen können; was – in den Parteien – Politiker mit eher unpolitischen, eher in den eigenen Geschäften aufgehenden Anhängern verbinden kann. Geschäfte spielten überhaupt keine große Rolle. Eben daher ließ sich grundsätzlich bei vielen eine Bereitschaft erzeugen, sich stark am Politischen zu beteiligen. Nur – dann mußten sie regelmäßig im Zentrum der Politik, auf der Agora anwesend sein, sich also stark als Bürger engagieren. Nicht nur, wenn besondere Anlässe sie erregten, sondern immer. Wie aber konnte das gehen?
Dazu brauchte es lange, intensive Vorbereitungen. Kenntnisse mußten verbreitet werden, kollektive Urteilsfähigkeit heranwachsen, ein Bewußtsein der Verantwortung war zu wecken. Ja, es mußte allererst der Anspruch auf regelmäßige, nachhaltige Mitsprache begründet und als legitim erwiesen werden. Es waren Formen zu finden, durch die die Anwesenheit der Bauern auf der Agora vermittelt werden konnte: Eine Neuorganisation der Bürgerschaft und eine Weise, in der sie vertreten werden konnte – ohne daß die Vertreter dabei zu mächtig geworden wären, also im ständigen jährlichen oder noch kürzerfristigen Wechsel, welcher gleichsam eine indirekte Form regelmäßiger Anwesenheit aller ermöglichte. So ließ sich die Bürgerschaft „politisieren“; in einer Weise, daß später die Demokratie daran anknüpfen konnte. So ließ sich auf griechische Weise, in diesen Gemeinwesen, in denen sich so viel im unmittelbaren Mit- und Gegeneinander entschied, für Gerechtigkeit sorgen: Denn da konnte man ja nicht letztlich an Könige appellieren, wie im Orient, sondern man mußte – und konnte – die Machtverhältnisse ändern, damit man der Willkür und willkürlicher Justiz nicht ausgeliefert war.
Dieser Wandel der Bürgerschaft muß durch eine allmählich sich verbreitende Strömung politischen Denkens angetrieben und unterfüttert worden sein. Natürlich gab es auch in dieser Gesellschaft kluge Männer. Natürlich wurden sie um Rat gefragt. Sahen sie sich bemüßigt, den Anforderungen zu genügen, tauschten sich aus und lernten dazu. Vielleicht kann man sagen, daß die allgemeine Not die sonst so leicht grassierende Beratungsresistenz vielfach durchbrach. Diese Öffentlichkeit war auch auf die Dauer zu wach, um dergleichen zu dulden. Es gab keinen König, der die klugen Männer in seinen Dienst hätte ziehen können. Sie waren also unabhängig. Primär ihrer Einsicht und der Sache der Polis, wie sie sich allmählich herauskristallisierte, verpflichtet.
Es spielte sich ein, daß Städte in kritischen Situationen, wenn etwa Bürgerkrieg oder Tyrannis drohte, einen von ihnen mit der Aufgabe betrauten, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Manche Reformen, etwa die Befreiung von Schuldenlasten, waren zwar schwierig, aber mit den nötigen Vollmachten zu erledigen. Doch erwartete man von ihnen ja auch, daß sie die Gemeinwesen instand setzten, ihr Zusammenleben des weiteren aus eigener Kraft zu besorgen. Sie mußten also auch die verschiedenen Kräfte genau studieren, die da vorhanden waren, und sich die Frage vorlegen, wie sie in ein halbwegs vernünftiges Verhältnis zueinander zu bringen und darin zu halten waren. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß sie mit der Zeit darauf kamen, daß das nur gelang, wenn die Bürgerschaft selbst, das heißt vor allem die Mittelschicht, sich stark in der Polis engagierte. Und daß sie die Voraussetzungen dafür erdachten und schließlich zu schaffen halfen.
So etwa könnte man die wichtigsten politischen Antworten umreißen, welche die Griechen auf die Herausforderung der Freiheit in ihren kleinen Gemeinwesen fanden. Aber die Frage war ja, ob nicht die ganze Kultur – oder schränken wir ein: zumindest weite Teile davon – Antwort auf diese Herausforderung gewesen sei. Wie wäre das zu verstehen?
Beginnen wir mit den Versuchen, die Gemeinwesen wieder ins Lot zu bringen. Wer damit betraut war, konnte wie ein Monarch wirken, wenn es galt, akute Mißstände zu beheben. Andererseits mußte er – in Hinblick auf die Zukunft – sich selbst wegdenken. Die Gemeinwesen – anders gesagt: die verschiedenen Kräfte in ihnen – sollten ja befähigt werden, sich selber zu halten; in der richtigen Balance.
Wenn sich ein solches Problem im Politischen stellt, drängt es sich auf, es auch anderswo, insbesondere im Kosmos zu verfolgen. Genau das finden wir bei einem der ersten griechischen Philosophen, Anaximander von Milet. Er war umgetrieben unter anderem von der Frage, wie sich die Erde hält, im Wechselspiel mit andern Körpern des sie umgebenden Himmelskreises nämlich. Er war aber auch den Gesetzmäßigkeiten auf der Spur, die im Kosmos walteten und verstand sie – ganz entsprechend denen, die sich im Politischen beobachten ließen. Wohl haben die griechischen Philosophen sehr viel Weisheit aus dem Orient übernommen. Aber diese Weise zu fragen und zu forschen, scheint mir so stark von den Herausforderungen griechischer Freiheit her bestimmt zu sein, daß man sie speziell für die Griechen reklamieren kann. Durch sie also sind, wenn das richtig ist, die Anfänge griechischer Philosophie und Wissenschaft bestimmt.
Und weiter: Einer der großen politischen Denker, Solon von Athen, hat von dem „unsichtbaren Maß der Erkenntnis“ gesprochen, „das allein von allen Dingen die Enden in der Hand hält“. Es sei am allerschwersten zu denken. Das muß das Verhältnis zwischen den Kräften gewesen sein, das Maß, gemäß dem man – nach dem Denken der Zeit – den verschiedenen Kräften zuzuteilen hatte, was ihnen gebührte, das Maß der Gerechtigkeit also. Denn man glaubte doch, daß in einer rechten Ordnung allen das Ihre zukomme.
Die Mahnung, maßvoll zu sein, hatte das Delphische Orakel mit aller Macht den Griechen eingeschärft. Aber damit war zunächst nur gemeint, daß man sich mäßigen sollte. Jetzt wird beobachtet, daß der Blick auf das Ganze, der vermutlich zunächst die Polis im Auge hatte, bei verschiedensten Gegenständen die Frage nach den rechten Maßverhältnissen dringend machte. Im Tempelbau sucht man nach den richtigen Proportionen zwischen Höhe und Breite; man nimmt das Joch zwischen zwei Säulen zum Grundmaß, von dem alle anderen abzuleiten waren. Nicht lange, und Hippodamos von Milet entwirft einen Stadtplan, in dem alles in den rechten Maßen und an den rechten Orten angeordnet war. Das gleiche beschäftigte die Musiker, für welche Oktave, Quint oder Quart Ausdruck ausgezeichneter Zahlenverhältnisse waren. Und speziell den Zahlen widmete sich die Mathematik und Philosophie des – von Reuchlin so hoch geschätzten (und mit jüdischer Weisheit in Verbindung gebrachten) – Pythagoras. Später ging Polyklet den Maßverhältnissen des menschlichen Körpers nach. Überall also sucht man nach abstrakten Verhältnissen, nach einer letztlich vorgegebenen abstrakten Ordnung. Man kann es kaum anders verstehen denn als Ausdruck der Tatsache, daß, wo kein Subjekt herrschen soll, die Suche nach einem Objektiven, nach dem Maß das Korrelat der Freiheit ist. Gewiß, ohne spezifische Maßverhältnisse geht es auch anderswo nicht. Aber hier scheinen sie geradezu existentiell gebraucht worden zu sein. Es scheint, daß in diesem vielfach so maßlosen Volk geradezu im Übermaß nach dem Maß gestrebt worden ist – auf der ganzen Skala kultureller Äußerungen und mit herrlichen Ergebnissen.
Oder ein dritter Komplex von Beispielen: Schon frühzeitig müssen unter diesen so freien, so unabhängigen, auf sich gestellten, also auch besonders verletzlichen, rasch zu Vergeltung und Rache neigenden Herren vielerlei Fähigkeiten zur Balancierung sich ausgebildet haben. Untereinander und in sich selbst.
Ein wesentlicher Teil des Problems hat seinen Niederschlag schon im ältesten literarischen Werk der Griechen, Homers Ilias gefunden. Denn die überlieferten Sagen von den Kämpfen der Helden sind dort ja eingebunden in die Geschichte des Grolls des Achill, des Beleidigten, der mit allen Mitteln versöhnt werden muß. Es gilt nicht Befehl und Gehorsam, sondern der – immer wieder versuchte – Ausgleich unter Gleichen. Daß Homer auch die besondere, politisch versöhnende Rolle der Anmut hervorhebt, verweist auf die Menschenbildung, die diese Gesellschaft von Freien notwendig machte (und die sich dann in der Kunst im archaischen Lächeln wieder findet). Die griechische Kultur hat in besonders hohem Maße darin bestanden. Vielleicht muß man auch die besonders starke Ausbildung des Wettbewerbs bei ihnen in diesem Zusammenhang verstehen.
Zu der Balance unter Gleichen und Freien gehört es, daß man sich der Regeln, der moralischen Gebote, der Tugenden vergewissert. Auch die Anerziehung von Affektkontrollen, welche jede Zivilisation erfordert, konnte bei den Griechen ja nicht von Höfen ausgehen, sondern mußte im Miteinander ins Werk gesetzt werden. Im Dienst dieser Bemühung gewann das Symposion im kleinen Kreise seine Bedeutung. Auch hier ein Wettbewerb. Man trinkt nicht nur, sondern trägt auch vor, zu jeweils festgelegten Themen. Wir kennen die Ergebnisse aus der frühgriechischen Lyrik.
Diese Lyrik antwortet zugleich auch insofern auf die Herausforderung der Freiheit, als sie die Probleme des so weitgehend auf sich gestellten Einzelnen in den wundervollsten Versen zu Wort bringt: die ungeheuerliche Wechselhaftigkeit des Lebens, die so deutlich erfahrenen Grenzen, in denen der Mensch Herr seiner Entschlüsse, in denen er verläßlich ist; und den Punkt, an dem er den Hebel ansetzen kann, um mit allem fertig zu werden: bei sich selbst – wenn er nämlich die nötige Ertragekraft entwickelt. Immerhin geht es um Weisen individueller Selbstbehauptung.
Wie sich aus ägyptischen Vorbildern der griechische kouros entwickelt, als Bild nicht der Inhaber eines besonderen Ranges, sondern des nackten Menschen, in höchster Gesammeltheit, auch er ganz auf sich gestellt, voller Kraft, voller Anmut und Selbstbeherrschung, könnte man hier anfügen.
Wenn die griechischen Eigentümlichkeiten in all diesen Punkten – vielleicht – zumal in Feinheiten bestehen, so sollte man sich klarmachen, wie viel Feinheiten (und wie viel geringe Prozentsätze Besonderheit) ausmachen können. 98,8 % der Gene haben Menschen und Schimpansen gemeinsam. An 1,2% hängt der Unterschied.
Schließlich ein Letztes: Durch eigenartige Verknüpfungen gelingt es diesen Griechen in dem Moment, in dem sie in Konflikt mit dem an Macht so weit überlegenen Orient geraten, dessen Angriff, genauer gesagt: die Offensive des Persischen Weltreichs abzuwehren.
Indem sie sich weiterhin zu sichern suchen, gewinnt Athen, das stärkste griechische Gemeinwesen, eine führende Stellung. Über Nacht wird es vom Kanton zur Großmacht, und wenig später kommt es in ihm zu einer radikalen Demokratie.
Ungeheuerliche Probleme sind damit gegeben. Tiefe Klüfte tun sich zwischen Hergebrachtem und Angebrachtem auf. Man tut, was angebracht ist, aber das Hergebrachte spukt noch in den Köpfen. Zu plötzlich war der Übergang. Und alles beschleunigt sich.
Im Vordergrund stehen für die Athener normalerweise die politischen und militärischen Probleme und Entscheidungen. Aber dahinter öffnen sich andere, sehr viel tiefere, allgemeinere Fragen. Und man nimmt es mit ihnen auf eine ganz erstaunliche Weise auf. Das findet seinen Niederschlag in weiteren, hochbedeutenden Antworten auf die Herausforderung der Freiheit. Als Ausdruck zumal der daraus resultierenden Verantwortung, des umfassenden Sich-gefragt-, des Sich-zu-Antworten-gefordert-Sehens.
Nicht nur von Fall zu Fall und nicht nur im folgenlosen Gerede, sondern in hoher literarischer Form nimmt man es mit all den Fragen auf, die sich stellen. Man will wissen, woran man ist, modern gesprochen: auf der Höhe der Zeit sein. Nicht nur, was im Einzelfall, sondern, was überhaupt gerecht und ungerecht ist, wird Gegenstand der vor allem Volk aufgeführten Tragödien. Man plant nicht nur, sondern erschrickt auch vor der allgemeinen Frage, was der Mensch überhaupt zu tun und zu planen vermag. Was kann er, was vermag seine Vernunft, wo fällt er der Verblendung – wir könnten sagen: dem pathologischen Lernen, wie man es gerade auch in Demokratien erfahren kann – anheim? Was ist ihm überhaupt zugeteilt? Ja, was ist der Mensch?
Demokratie bedeutet, über die eigene Ordnung verfügen zu können. Und genau das tun künftig die Bildhauer, indem sie Menschen nicht mehr nach vorgegebenem Muster, sondern aus freier Entscheidung über den ganzen Aufbau der Figur formen.
Wenn nicht Götter das Geschehen lenken, wenn das Handeln des politischen Verbandes nicht Sache eines Königs ist, man zudem, weil man an den Entscheidungen beteiligt ist, an sich selber merkt, wie die Dinge laufen, muß man auch die Abläufe verstehen lernen und entdeckt die Geschichtsschreibung.
Sophisten fragen, ob es Götter gibt. In den erregten Diskussionen prallen die verschiedensten Meinungen aufeinander. Alles scheint relativ zu sein. Nicht zuletzt das Recht, welches hier so, dort so erscheint und vor allem immer wieder verändert wird.
Was also hat zu gelten, jenseits aller Unterschiede zwischen den vielen Ordnungen? Was ist, was will die Natur, die vom Menschen unabhängige, die nicht verfügbare? Wieder begegnet die Suche nach dem Objektiven. Sie wird schließlich von Platon aus der Erfahrung der zeitweise bis ins Zügellose gesteigerten attischen Demokratie (und der Reaktion darauf) aufs Äußerste vorangetrieben. Über viele seiner Antworten wird man künftig sehr unterschiedlich denken. Aber seine Fragen sind so dringend, so weit und in die Tiefe getrieben, daß sie bis heute nicht zur Ruhe gekommen sind. Und auf Platon folgt Aristoteles.
Zumal die Tragödie lebt im und von der Resonanz der breiten Schichten. Geschichtsschreiber tragen ihre Werke in der Öffentlichkeit vor – wie es zugleich mit Homers Epen geschieht. Und auch die sophistischen Debatten dringen dorthin vor. Die Sprache der politischen Denker hat schon lange auf die Angehörigen breiter Schichten sich ausgerichtet. Selbst die Kommissionen, die den Bau des Parthenon überwachen, sind nichts anderes als Ausschüsse der Volksversammlung. Es ist also, zwar nicht ausschließlich, aber doch weithin, eine demokratische Kultur, die im fünften Jahrhundert zu ihrer Blüte kommt.
Man kann die griechische Hinterlassenschaft sehr unterschiedlich verstehen. Auch dem Stumpfsinn sind keine Grenzen gesetzt. Aber wenn man sich fragt, warum diese Griechen erst die Römer, dann (in geringem Maß) das mittelalterliche, schließlich in großem Maß das neuzeitliche Europa fasziniert haben, so muß man nach meinem Urteil über alle Einzelheiten hinaus die Freiheit nennen, aus der sie die menschlichen Möglichkeiten so großartig aus der Mitte der Gesellschaft heraus entfaltet haben. Die Freiheit, die in ihrer Hinterlassenschaft vibriert; jedenfalls in ihren Fragen, weithin aber auch in ihren Antworten. Etwas davon ist schon in der christlichen Theologie enthalten, sofern sich diese weitgehend aus griechischer Philosophie gespeist hat.
Was das ausgemacht hat? Sehr schwer zu sagen. Jedenfalls zeichnet sich das mittelalterliche und vor allem das neuzeitliche Europa durch eine ungeheure Dynamik aus, ganz im Unterschied zu den Griechen. Nie sonst haben sich so viele Kräfte neben- und gegeneinander in einer Kultur entfaltet und gegenseitig angetrieben. Monarchie und Adel, weltliche und geistliche Macht, Städte, Klöster, Universitäten etc., und all das in verschiedenen Stufen, bald mehr in diesem, bald mehr in jenem Land, und trotzdem alles im Miteinander verwoben. Wenn Graf Kielmansegg vor kurzem festgestellt hat, daß Gewaltenteilung wahrscheinlich das elementarste Strukturmerkmal europäischer Zivilisation überhaupt ist, so gilt in Hinsicht auf die Zentren der Kulturbildung Entsprechendes: Es waren immer mehrere nebeneinander. Und da die Ressourcen stets zu knapp waren, angesichts der Vielheit derer, die darauf Anspruch erhoben, und dem Nachdruck, mit dem sie das taten, wurden in einem ungeheuren Ausmaß neue geschaffen.
Vielleicht aber war das nicht das einzige, was diese Geschichte vorantrieb. Vielleicht brauchte man – neben dem römischen Recht und darüber hinaus – all das, worin noch die griechische Freiheit vibrierte? Und sei es zur Kompensation der Dynamik?
Wenn dem so ist, so hat das Griechische, das Reuchlin als erster nach Deutschland gebracht hat, überaus wichtige Dienste für Europa geleistet. Und es hätte seine tiefe Bedeutung, daß auf dem Titelblatt eines 1521 erschienenen Buches (neben Martin Luther und Ulrich von Hutten) Reuchlin als patronus libertatis, Schutzherr der Freiheit gerühmt wird.
Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder Netzwerken, Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk oder Vortrag - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors.
Nach oben
|