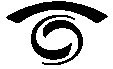„Im Zeichen der globalen Kommunikation dringt die Weltzeit in die individuelle Lebenszeit ein.
Es sieht so aus, als würde die Weltzeit die individuelle Lebenszeit verschlingen, als käme es nicht
mehr auf sie an. Aber es kommt auf sie an. Inter individuellen Lebenszeit entscheidet sich für den
einzelnen alles. Was geometrisch eine Unsinnigkeit ist, kann Lebenspraktisch gelingen, nämlich,
dass der größere Kreis im kleinen Kreis der eigenen Lebenszeit enthalten ist, ohne ihn zu sprengen.
Davon erzählt Johann Peter Hebel in der wunderbaren Geschichte vom „Unverhofften Wiedersehen“.
Keineswegs zufällig nimmt Rüdiger Safranski Bezug auf Johann Peer Hebel, wenn es um die Frage
des Abstandnehmens zur Globalisierung geht. Denn nicht nur in seiner zu Recht hochgeschätzten
Erzählung vom Bergmann, der nach fünfzig Jahren im Vitriolwasser einer verschütteten Grube
unverwest aufgefunden wurde, erinnerte der erste Prälat der badischen Landeskirche an die
Bedeutung eines zur Selbstbestimmung fähigen Individuums. Wie ein roter Faden durchzieht die
Aufforderung zum Selberdenken das gesamte Werk des menschenfreundlichen Spätaufklärers.
Johann Peter Hebel (1760-1826) gestaltete das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft
völlig konträr zu den utopischen Tendenzen des neuzeitlichen Denkens.
Dieses ging ja zur Durchsetzung seiner Ziele über die Privatgeschichte hinweg und opferte das
Einzelschicksal den Interesse der Partei, des Staates, des Volkes.
Für Hebel dagegen war das selbstständige Individuum, war der mündige Christ das Ziel der
Aufklärung. Der Mensch, der selbst für seine moralischen Entscheidungen, für seine Kraft zum
Leben, für seine Heiterkeit und Gelassenheit, für seine Ent-Schleunigung verantwortlich ist.
Geboren wurde Johann Peter Hebel am 10.Mai 1760 in Basel.
Nach der Volksschule in Hausen und der Lateinschule in Schopfheim besuchte er von 1774-1778
das Karlsruher Gymnasium illustre – das heutige Bismarckgymnasium – und wohne während
dieser Zeit in der Herrenstraße 5.
An der damaligen Hochburg der theologischen Aufklärung (Neologie), an der Universität in
Erlangen, setzte Hebel seine theologische Ausbildung bruchlos fort und kehrte nach seiner
Tätigkeit als Hauslehrer in Hertingen und Vikar in Lörrach, 1791 an seine ehemalige Schule
zurück. An dieser Ausbildungsstätte zukünftiger Pfarrer und Staatsbeamter arbeitete Hebel
zunächst als Subdiakon. 1798 wurde er zum Professor und 1808 sogar zum Direktor ernannt.
Auf seine Landsleute wirken, „ihre moralischen Gefühle“ anregen, wollte Hebel mit seinen
Alemannischen Gedichten (1803), die ihn schlagartig zu einer literarischen Berühmtheit machten.
1808 übernahm Hebel die Redaktion des „Badischen Landeskalenders“ und „reformierte“
diesen erfolgreich zu einem polulären Volkskalender, dessen unterhaltsame und lehrreiche
Geschichten den Geschmack des Publikums tragen.
Mit seinem „Rheinländischen Hausfreund“ setzte Hebel das um, was er sich unter Volksaufklärung
und Popularästhetik vorstellte – Humanität und Lebensklugheit für jedermann.
Der Höhepunkt seiner schriftstellerischen Karriere war zweifellos das Erscheinen des
„Schatzkästleins des rheinischen Hausfreundes“ (1811) – einer Sammlung von 128 seiner
bisherigen Kalenderbeiträge. Wahrscheinlich ist das „Schatzkästlein“ das populärste deutsche
Buch mit Erzählungen. Vom Erfolg her vergleichbar etwas mit der Resonanz auf La Fontaines
Fabeln oder Tolstois Volkserzählungen.
Kein Wunder, dass auch die heutige, jüngere Erzählergeneration (Arno Geiger, Arnold Stadler,
Patrick Roth …) von Hebels präzis kalkulierter Kurzprosa schwärmt.
Zu Beginn seiner Karlsruher Zeit wohne Hebel zunächst im Obergeschoss des Gasthofs Bären
(heute Café am Markt), dann ab 1808 und nach mehreren Zwischenstationen im südlichen
Seitenflügel der Stadtkirche am Marktplatz. Dort befindet sich heute eine Gedenktafel.
Später wohnte er u.a. in der Hebelstraße 4, in der Kreuzstraße 14, in der Karl-Friedrich-Straße 8,
in der Erbprinzenstraße 1 und zuletzt, bis zu seinem Tod 1826 in Schwetzingen, in der
Erbprinzenstraße 27.
Wer über Hebel forschen will, muss nach Karlsruhe. In die Badische Landesbibliothek
(Handschriften), ins Generallandesarchiv, Landeskirchenamt und Bismarckgymnasium
(Dokumente zu seiner beruflichen Tätigkeit), sowie, nach dem Erwerb der umfangreichen
Karl-Fritz-Sammlung, ins Museum für Literatur am Oberrhein (Erstausgaben, Übersetzungen,
schwer zugängliche Sekundärliteratur, Illustrationen usw.).
Dort, im „Hebelzimmer“, steht auch der ehemalige Schreibtisch des badischen Dichters von
Weltrang.
Wie einseitig in der Vergangenheit Hebels Werk rezipiert wurde, zeigt der Extremfall, dass es
trotz der offenkundigen Sympathie für die „Morgenländer“, wie Hebel in der Tradition Herders
die Juden nannte, von den Nationalsozialisten für ihre „Blut und Boden“-Idealogie in Anspruch
genommen werden konnte. Unverändert die Zeit überdauert hat Hebels „Ethik der Konkretion“;
immer noch lebendig ist sie in jedem „echten“ Karlsruher, der die Zeiten, die man auf den im Schlossgarten aufgestellten Hebeldenkmal lesen kann, auswendig kennt:
„Un wenn de an e Chrützweg stohsch, un nümme waisch, wo’s ane goht, halt still un froog dy
Gwisse zerst, ‚s cha Dutsch gottlob, un folg sym Root!“
Die Absicht zu belehren und zu nützen sollte aber nach Hebels Ansicht nicht voranstehen, sondern
„hinter dem >studio placendi< (dem Eifer, zu gefallen) maskiert und desto sicherer erreicht werden.“
Wie Hebel diese Absicht verwirklichte, zeigt folgende Kalendergeschichte, in der Enzberg eine
gewisse Rolle spielt.
„Nur weil es unter allen Ständen einfältige Leute gibt, gibt es solche auch unter dem achtungswerten Bauernstand; sonst wär es nicht nötig. Ein solcher schob eines Morgens einen schwarzen Rettich und
ein Stück Brot in die Tasche, und „Frau“, sagte er, „gib acht zum Haus, ich gehe jetzt in die Stadt“. (Pforzheim vermutlich). Unterwegs sagte er von Zeit zu Zeit: „Dich will ich bekommen. Mit dir will ich fertig werden“, und nahm allemal eine Prise darauf, als wenn er den Tabak meinte, mit ihm woll er
fertig werden, er meinte aber seinen Schwager, den Ölmüller.
In der Stadt ging er geradewegs zu einem Advokaten und erzählte ihm, was er für einen Streit habe
mit seinem Schwager wegen einem Stück Reben im untern Berg und wie einmal der Schwed am
Rhein gewesen sei und seine Voreltern darauf ins Land gekommen seien, der Schwager aber sei
von Enzberg im Württembergischen, und der Herr Advokat soll jetzt so gut sein und einen Prozess
daraus machen.
Der Advokat mit seiner Tabakspfeife im Mund, sie rauchen fast alle, tat gewaltige Züge voll Rauch,
und es gab lauter schwebende Ringlein in der Luft, der Adjunkt kann auch machen.
Dabei war er aber ein aufrichtiger Mann, als Rechtsfreund und Rechtsbeistand natürlich.
„Guter Mann“, sagte er, „wenns so ist, wie ihr mir das vortragt, den Prozess könnt ihr nicht
gewinnen“, und holte ihm vom Schaft das Landrecht hinter einem porzellinen Tabakstopf hervor.
„Seht da,“ schlug er ihm auf, „Kapitel soundsoviel, Numero vier, das Gesetz spricht gegen Euch unverrichteter Sachen.“
Indem klopft jemand an der Türe und tritt herein, und ob er einen Zwerchsack über die Schulter
hängen hatte und etwas drin, genug, der Advokat geht mit ihm in die Kammer abseits.
„Ich komm gleich wieder zu Euch.“
Unterdessen riß der Bauermann das Blatt aus dem Landrecht, worauf das Gesetz stand, drückte
es geschwind in die Tasche und legte das Buch wieder zusammen. Als er wieder bei dem Advokaten
allein war, stellte er den rechten Fuß ein wenig vor und schlotterte mit dem Knie ein paar Mal ein-
und auswärts, teils weil es dortzuland zum guten Vortrag gehört, teils damit der Advokat etwas
sollte klingeln hören oben in der Tasche. „Ihr Gnaden“,sagte er zu dem Advokaten, „ich hab mich unterdessen besonnen. Ich meine, ich wills doch probieren, wenn Sie sich der Sache annahmen wollten“, und machte ein verschlagenes Gesicht dazu, als wenn er noch etwas wüsste und sagen wollte:
>Es kann nicht fehlen<. Der Advokat sagte: „Ich habe aufrichtig mit Euch gesprochen und Euch
klaren Wein eingeschenkt.“
Der Bauermann schaute unwillkürlich auf den Tisch, aber er sah keinen.
„Wenn ihrs wollt drauf ankommen lassen“, fuhr der Advokat fort, „so kommts mir auch nicht
drauf an“. Der Bauersmann sagte: „Es wird nicht alles gefehlt sein“.
Kurz, der Prozeß wird anhängig und der Advokat brauchte das Landrecht nicht mehr weiters dazu,
weil er das Gesetz auswendig wusste, wie alle. Item, was geschieht?
Der Gegenpart hatte einen saumseligen Advokaten, der Advokat verabsäumt einen Termin, und
unser Bauersmann gewinnt den Prozeß.
Als ihm nun der Advokat den Spruch publizierte, „aber nicht wahr“, sagte der Advokat,
„diesen schlechten Rechtshandel hab ich gut für Euch geführt?“
„Den Kuckuck hat Er“, erwiderte der Bauersmann und zog das ausgerissene Blatt wieder aus der
Tasche hervor = „Sieht er da? Kann Er gedruckt lesen? Wenn ich nicht das Gesetz aus dem Landrecht gerissen hätte, Er hätt den Prozeß lang verloren.“ Denn er meinte wirklich, der Prozeß sei dadurch zu seinem Vorteil ausgefallen, dass er das gefährliche Gesetz aus dem Landrecht gerissen hatte, und auf
dem Heimweg, sooft er eine Prise nahm, machte er allemal ein pfiffiges Gesicht und sagte:
„Mit dir bin ich fertig geworden Ölmüller“. Item: So können Prozesse gewonnen werden.
Wohl dem, der keinen zu verlieren hat.
Soweit Hebels Kalendergeschichte von 1813: „Der Prozeß ohne Gesetz“.
Weil der Schwager des Ölmüllers aus Enzberg die Worte des Advokaten („Ich habe Euch klaren
Wein eingeschenkt“) als Realität nimmt (Er „schaute unwillkürlich auf den Tisch, aber er sah keinen“), wegen seiner Einfältigkeit also, hat er überhaupt keinen Zugang zur Komplexität der neuen Rechtsverhältnisse nach der Einführung des Code Civil in Baden, der dort seit dem 1. Januar 1810
in Kraft ist.
Genau darüber möchte Hebel aufklären: über die Mechanismen der Justiz, über den Vorrang des Formalen, über den Charakter des „wissenschaftlichen“ Rechts, in dem es z.B. so etwas wie „Versäumnisurteile“ gibt.
Aber auch wenn Heben die Einfältigkeit des Bauern aus Enzberg vorführt, bleibt er der Humanität verpflichtet: Leute, die mit magischen Akten die Realität zu bewältigen versuchen bzw. eine Seite aus
dem Gesetzbuch herausreißen, so schreibt er gegen gängige Vorurteile, „gibt es unter allen Ständen!“
Mit seinem „Rheinländischen Hausfreund“ wollte Heben seine Leser unterhalten.
Er war für ihn aber auch ein wichtiges Instrument einer lebenspraktischen Volksaufklärung.
Wie dem römischen Dichter Horaz ging es Hebel um die Verknüpfung von electare (erfreuen) mit
dem prodesse (nützen). In diesem Sinne war der „Prozeß ohne Gesetz“ etwas zum Schmunzeln;
aber auch eine Warnung vor dem weit verbreitetem Prozessieren nach dem Motto:
Friede ernährt, Unfriede zerstört.
Juristische Streitereien waren es unter anderem, die dafür sorgten, dass Pforzheim nicht gerade der Lieblingsort Hebels wurde. Auch wenn er ein menschenfreundlicher und toleranter Aufklärer war
– an einem gewissen Punkt riss auch ihm der Geduldsfaden. So im Fall seines Pforzheimer Verlegers
und Druckers Johann Michael Katz.
Welche Probleme es mit ihm gab, berichtete er im Brief vom 6.4.1825 seinem anderen Verleger
Johann Friedrich Cotta: „Ich bedaure sehr, verehrteter Freund, was sie über den katzischen Unfug zu klagen haben. Es ist sogleich aus der evangelischen Kirchensektion ein Drehortatorium (also eine Anstandsermahnung) abgegangen. Obgleich ich sie dadurch noch nicht für gesichert halte, so ist es
doch das einzige, was vorerst von hier aus geschehen konnte. Ich stelle Ihnen aber anheim …, ein Inhibitorium (also eine einstweilige Verfügung) beim Amt in Pforzheim zu bewirken.“
Was war passiert?
Hebel hatte, wie aus seinem Brief vom 14. Februar 1823 an seinen Verleger Cotta hervorgeht,
vereinbart, dass Katz die Schulbuchausgabe der Biblischen Erzählungen „auf eigene Rechnung“
drucken und verkaufen dürfe. Aber nur für Schulen. Katz hielt sich jedoch nicht an diese Abmachung
und machte Cotta auch im freien Verkauf Konkurrenz. Ein klarer Fall von Vertragsbruch also.
„Wollen Sie diesen Schritt (also das Inhibitorium“) wählen“, so heißt es in Hebels Brief weiter,
„und mich gefällig in Kenntnis setzen, so werde ich von hier aus privat an Herrn Obervogt (also Oberbürgermeister) Deimling in Pforzheim schreiben.“
Klagen über Buchdrucker Katz, der im Jahr 1810 (zusammen mit dem Karlsruher Verleger Macklot)
und ab 1813 (zusammen mit dem Verleger Geiger aus Lahr) Pächter des „Rheinländischen Hausfreunds“ war, gibt es zahlreiche in Hebels Briefen.
So schreibt er z.B. im Jahr 1814 (1.2.) an seinen Adjunkten (Gehilfen) Christoph Friedrich Kölle:
„Wenn ich Euch frage, Lieber Hausfreund Adjunkt, ob ihr durch den Katz unsern Kalender erhalten
habt, so sprecht Ihr ohne Zweifel Nein und macht ein Gesicht dazu, als ob Euch nicht viel daran
gelegen wäre, letzteres mir zum Trost. Ich hatte nemlich schon bei der ersten Erscheinung der
populären Ausgabe (solche ohne leere Seiten für Notizen) dem Pforzheimer befohlen wie viele
vornehme Exemplare (gemeint sind Kalender mit leeren Seiten nach jedem Monat für Notizen) er mir,
und an wen er solche in meinem Namen schicken sollte.“
Wie so vieles in seinem Leben nahm Hebel diese Befehlsverweigerung seines Pforzheimer Verlegers
mit Humor und Gelassenheit; er konnte aber auch, wenn es darum ging, Veränderungen zu bewirken,
z.B. die Schlampigkeit, mit der Katz seinen Kalender druckte, das Mittel der Ironie so geschickt
einsetzen, dass der Streitfall zu seinen Gunsten entschieden wurde: Von den Lachern nämlich, die er auf seiner Seite hatte. Das Risiko eingehend, dass so etwas einmal gut tut, ein andermal nicht, schrieb er diesbezüglich in der Vorrede zum Kalender auf das Jahr 1813:
„Anno Eile hat er gesagt, in Zukunft hoffe er, solls mit dem Kalender besser werden. Er hat nicht gesagt, >im nächsten Jahr<, sondern in Zukunft, nämlich von Anno Dreizens an. Denn der rheinländische Hausfreund hat sich jetzt sesshaft niedergelassen in Lahr … und hat mit dem Herrn Buchdrucker Geiger allda und mit dem Buchdrucker Katz in Pforzheim so zu sagen gemeine Sache gemacht von wegen des Kalenders … Denn der Herr Buchdrucker Geiger sagt, er wolle den Hausfreund schon drucken und pressen, dass es eine Art habe, nicht anders wie sein eigenes Kind, nämlich den Lahrer Hinkenden
Boten, und der Herr Buchdrucker Katz will auch nicht ermangeln lassen. Erstlich versprechen sie bei Verlust des Privilegiums, wieder jeden Bogen besonders zu drucken, wie es ehmals geschah, und in
ihrer Druckerei sei es nie anders üblich gewesen.“
Die Rede ist hier von der Druckqualität der Jahrgänge 1808 und 1809. In der Tat wurde der Druck
nun um einiges klarer und deutlicher, dafür nahm aber die Zahl der Setzfehler zu:
„Zweitens sagt der Herr Geiger, man bekommt heutzutag kein gutes Ziegelmehl mehr, ich will lieber Zinnober nehmen.“
Weil sich das Rot von Zinnober bzw. Quecksilbersulfid erst entfaltete, wenn es lange trocken gerieben wird, war die auf Hebels ausdrücklichen Wunsch wieder eingeführte rote Farbe eine aufwändige Angelegenheit.
„Drittens sieht er’s zwar als eine sehr nützliche Übung der Kinder im Buchstabieren an, wenn man
zwei Zeilen in einander hineindruckt, eine mit roten Buchstaben und eine mit schwarzen, damit die
Kinder die roten Feiertage aus den schwarzen Werktagen buchstabenweise herausklauben können,
wie man die Erbsen und Wicken auseinander liest.
Ja, er behauptet, wer gut mit der Schrift umgehen könne“, hier wird Hebel richtig sarkastisch, „habe überdies einen großen Vorteil dabei, dass er zwei Zeilen auf einmal lesen könne. Dessen ungeachtet,
sagt er, er sei kein Freund von Neuerungen, was auch löblich ist, und wolle lieber die Zeilen wieder
eine unter die andere drucken, eine nach der andern zu lesen, als beide auf einmal.“
Mit unüberbietbarer Ironie wird von Hebel auch das Problem der schlechten Abbildungen thematisiert:
„Sechstens, wenn der Herr Katz an die Abbildungen kommt, will er dem Papier den Model (also den Holzschnitt) dazu nicht nur von weitem zeigen, sondern er will in wirklich darauf drucken; ja wenn die Zeilen wieder besser werden, ist er auch im Stand, und lässt sie auch anstreichen.“
Eine andere Pforzheimer Persönlichkeit mit der Hebel zu tun hatte, war Johann Jeremias Herbster.
Ihm hatte er die Erstausgabe seiner Alemannischen Gedichte gewidmet. Auf dem Vorsatzblatt konnte
man lesen: „Meinem lieben Freund Herrn Berginspektor Herbster und dann meinen guten Verwandten, Freunden und Landsleuten zu Hausen im Wiesenthal zum Andenken gewidmet von J.P.H.
“ Herbster war der Direktor des Hausener Eisenwerks, in dem Hebel als Schüler in den Ferien
dringend notwendiges Geld verdiente, in dem er Holzkohlen schleppte, Steine zerkleinerte, am Schmelzofen half. Seinem Freund Engler teilte Hebel im Brief vom 20.3.1804 mit, dass der „unglückliche Berginspektor, an den ich nicht ohne tiefes Bedauern denken kann,“ auf dem „Brombacher Thor in Lörrach“ in Untersuchungshaft sitze. Später landete Herbster, und zwar wegen jahrelanger
Unterschlagung im Pforzheimer Zuchthaus, wo er später auch starb.
Zu Hebels Zeit befand sich das Pforzheimer Zuchthaus auf dem Platz des ehemaligen Siechenhauses
bzw. Frauenklosters zu St. Maria Magdalena. Weil dieses 1689 vollständig eingeäschert wurde, baute
man 1718 ein Zucht- und Waisenhaus; als Herbster dort seine Strafe abbüßte, galt es als eines der fortschrittlichsten. Beispielsweise lobte man den Direktor Eisenlohr „wegen seiner Einsichten und der vortrefflichen Einrichtung des Zuchthauses.“ Der badische Markgraf Karl Friedrich hatte 1767 die Tortur und 1783, als erster deutscher Fürst, die Leibeigenschaft abgeschafft. Auch vom Strafvollzug hatte er eine verhältnismäßig humane Auffassung. Nach seiner Ansicht sollte dieser „menschenwürdig“ sein. Er sollte zur Besserung führen. Aus diesem Grund verbot er sinnlose Quälereien. Vor allem war Karl Friedrich unzufrieden mit dem Umstand, dass sich neben den Verbrechern auch „Irre, Kranke, Waisenkinder, Pfründer (also Insassen eines Altenheims) und Fabrikarbeiter in der Anstalt befanden.
1758 wurde deshalb eine neue Zuchthausordnung verabschiedet, die „durchaus menschenfreundlich und religiös gehalten (war) und … den Sträflingen nichts unbilliges (zumutete).“
Weil Karl Friedrich im Gegensatz zum Buchdrucker Katz allem Neuen gegenüber aufgeschlossen war, bekam auch der berühmte Phrenologe Franz Josef Gall Einladungen an den Karlsruher Hof, wo ihn
Hebel kennenlernte. „Seit einer Woche“, schrieb er im Dezember 1806 „hält unser Landsmann (aus Tiefenbronn) Vorlesungen über seine neue Schädellehre … Und in der Tat scheinen mir seine Vorlesungen sehr lehrreich und seine Beobachtungen äußerst wichtig zu sein, wenn auch das System, das er darauf baut, nicht ganz fest stehen sollte.“
Ein Anhänger von Galls Schädellehre – und nicht Gall selbst, wie Walter Benjamin behauptete, dem Hebels Schädel zur Diagnose präsentiert wurde, fand an ihm „Scharfsinn, Schlauheit, Bedächtigkeit, Religion und Poesie“. Als er nach dem Abtasten einer gewissen Stelle an Hebels Kopf unter undeutlichem Gemurmel die Worte „ungemein stark ausgebildet“ vernehmen ließ, soll Hebel gefragt haben:
„Was, das Diebsorgan?“
Skeptisch war Hebel auch wegen einer weiteren damals prominenten Pforzheimer Persönlichkeit, die am Pfingstmontag 1823 in Rüppur predigte: „Das Kirchlein“, protokollierte Hebel im Brief an seinen Freund Haute vom 25.5., „war wenig voll. Kaum 20 Personen waren hier. Doch kam unerwartet und ganz allein der Großherzog (Ludwig) und setzte sich unter uns“. Welchen Grund hatte der Großherzog, am Pfingstmontag in einem Karlsruher Vorort eine Predigt zu hören?
Bei ihm war am 29. Januar eine „Deputation der katholischen Gemeinde Steinegg in der Audienz erschienen“, weil, wie Hebel sich ausdrückte, „sie mit Mann und Maus protestantisch werden wollte“.
Der als Sohn katholischer Eltern in Völkersbach bei Ettlingen geborene Aloys Hennhöfer (1789-1862) kam als Pfarrer ins Biet und wurde von 1815-1818 Erzieher im Hause des Freiherrn Julius von Gemmingen in Steinegg und danach Pfarrer von Mühlhausen. Seine Erweckungspredigten hatten einerseits einige Monate Haft in Bruchsal, aber auch den Übertritt eines Teils seiner Gemeinde zur Konsequenz.
Auf Wunsch des Großherzogs, dem die Predigt in Rüppur offensichtlich gut gefallen hatte, wurde Hennhöfer die Pfarrei Graben und später Spöck übertragen, wo er bis zu seinem Tod wirkte.
Der Pforzheimer Künstler Axel Hertenstein, der während des 2. Weltkriegs in Mühlhausen wohnte, erzählte mir, dass ihm noch lebhaft in Erinnerung sei, wie man im konfessionell zweigeteilten Dorf an
hohen Feiertagen vorsätzlich den kirchlichen Frieden störte und z.B. den Mist auf den Acker fuhr.
Wie Hebel über den Wechsel der Konfession dachte, macht seine Kalendergeschichte
„Die Bekehrung“ von 1811 deutlich:
„Zwei Brüder im Westfälinger Land lebten miteinander in Frieden und Liebe, bis einmal der jüngere Lutherisch blieb und der ältere katholisch wurde. Als der jüngere Lutherisch blieb und der ältere katholisch wurde, taten sie sich alles Herzeleid an. Zuletzt schickte der Vater den katholischen als Ladendiener in
die Fremde. Erst nach einigen Jahren schrieb er zum ersten Mal an seinen Bruder. „Bruder“; schrieb er, „es geht mir doch im Kopf herum, dass wir nicht einen Glauben haben und nicht in den nämlichen Himmel kommen sollen, vielleicht in gar keinen. Kannst du mich wieder lutherisch machen, wohl und gut, kann ich dich katholisch machen, desto besser.“
Also beschied er ihn in den „Roten Adler“ nach Neuwied, wo er wegen einem Geschäft durchreiste. „Dort wollen wirs ausmachen.“. In den ersten Tagen kamen sie nicht weit miteinander. Schalt der Lutherische: „Der Papst ist der Antichrist“, schalt der Katholische: „Luther ist der Widerchrist“.
Berief sich der Katholische auf den heiligen Augustin, sagte der Lutherische: „ich hab nichts gegen ihn, er mag ein gelehrter Herr gewesen sein, aber beim ersten Pfingstfest zu Jerusalem war er nicht dabei.“
Aber am Sonntag aß schon der Lutherische mit seinem Bruder Fastenspeise. „Bruder“, sagte er, „der Stockfisch schmeckt nicht giftig zu den durchgeschlagenen Erbsen“; und abends ging schon der Katholische mit seinem Bruder in die lutherische Vesper. „Bruder“, sagt er, „euer Schulmeister singt keinen schlechten Tremulant“. Den anderen Tag wollten sie miteinander zuerst in die Frühmesse, danach in die lutherische Predigt; und was sie alsdann bis von heute über acht Tage der liebe Gott vermahnt, das wollten sie tun. Als sie aber aus der Vesper und aus dem „Grünen Baum“ nach Hause kamen, ermahnte sie Gott, aber sie verstanden es nicht. Denn der Ladendiener fand einen zornigen Brief von seinem Herrn. „Augenblicklich setzt Eure Reise fort! Hab ich Euch auf eine Tridenter Kirchenversammlung nach Neuwied geschickt, oder sollt ihr nicht vielmehr die Musterkarte reihen?“ (hier geht es um das Tridentinische Konzil von 1545 bis 1563 zur Erneuerung der katholischen Kirche bzw. Abwehr der Reformation; die Musterkarte reisen: gemeint ist Ware anbieten nach der Musterkarte mir Proben von Stoffen, d.h. bei Kunden erfolgreich sein)
Und der andere fand einen Brief von seinem Vater: „Lieber Sohn, komm heim, sobald du kannst, du
musst spielen“. (gemeint ist: ein Los ziehen, was vor allem zum Zweck der Einberufung zum Kriegsdienst veranstaltet wurde.)
Also gingen sie nach dem nämlichen Abend unverrichteter Sachen auseinander und dachten jeder für
sich nach, was er von dem andern gehört hatte. Nach sechs Wochen schreibt der jüngere dem Ladendiener einen Brief: „Bruder, deine Gründe haben mich unterdessen vollkommen überzeugt.
Ich bin jetzt auch katholisch. Den Eltern ist es insofern recht. Aber dem Vater darf ich nimmer unter
die Augen kommen.“
Da ergriff der Bruder voll Schmerz und Unwille die Feder. „Du Kind des Zorns und der Ungnade,
willst du denn mit Gewalt in die Verdammnis rennen, dass du die seligmachende Religion verleugnest? Gestrigs Tags bin ich wieder lutherisch geworden.
Also hatte der katholische Bruder den Lutherischen bekehrt und der Lutherische hat den katholischen bekehrt; und war nachher wieder wie vorher, höchstens ein wenig schlimmer.
Merke: Du sollst nicht über die Religion grübeln und tüfteln, damit du nicht deines Glaubens Kraft verlierst. Auch sollst du nicht mit Andersdenkenden darüber disputieren, am wenigsten mit Gelehrten, denn die besiegen dich durch ihre Gelehrsamkeit und Kunst, nicht durch deine Überzeugung. Sondern du sollst deines Glaubens Leben und, was gerade ist, nicht krumm machen. Es sei denn, dass dich dein Gewissen selber treibt zu schanschieren.“
Religiöse Koexistenz, das zeigt diese Geschichte, kann nicht funktionieren, wenn die Menschen nicht gelernt haben selbstständig zu denken bzw. zur eigenständigen Wahrheitssuche in der Lage sind.
Hebels Porträt, das in der letzten Zeit mehrfach in der Pforzheimer Zeitung abgebildet war, wurde von einem Pforzheimer gemalt. Philipp Jacob Becker, er wurde 1759 in Pforzheim geboren, war 1803 zum badischen Hofmaler und Galeriedirektor ernannt worden.
Zufrieden scheint Hebel mit dem Porträt nicht gewesen zu sein, denn im Januar 1810 schrieb er an seine Freundin Henriette Hendel: „Mit dem Porträt ist Holland in neuer Noth. So wie ich es jetzt von dem
immer noch kranken Becker empfange, kann ich es Ihnen … unmöglich schicken. Das Gesicht ist gestellt … Ich lasse mich, wenn ich nach Straßburg komme, anderst, kleiner, packlicher (handlicher, leichter zu verpacken) mahlen…
„Weil ich nun noch nie in Pforzheim gewesen war“, schrieb der damalige Hofdiakon im August 1795
an Gustave Fecht, „so wich ich ihm aus Eigensinn auch diesmal aus und schlug mich lieber über das Gebürg nach Langenalb“.
Später war es für Hebel nicht mehr so einfach, Pforzheim auszuweichen. Als Kirchenrat und Mitglied
des Konsistoriums musste er am Pforzheimer Pädagogium Prüfungen abhalten. Was für ein Martyrium
das für ihn war, offenbart sein Brief vom 7.8.1812: „Es graust mir 8 Tage lang, wenn ich nur nach Pforzheim soll“. Dass Hebel Prüfungen auch mit Humor zu nehmen wusste, zeigt folgende Passage
aus einem Brief vom April 1797: „Dies Jahr hatte ich den Markgrafen wieder in meinem Examen und
ich bin wohl bestanden, denn ich habe allein mehr gewusst, als meine Schüler, und blieb mir, wenn sie
alle stumm waren, keine einzige Antwort schuldig. Es ist übrigens eine kleine Kunst. (und jetzt bitte alle Kollegen, auch die vom Hebelgymnasium, herhören Man darf nur nichts fragen, was man selber nicht weiß.“
Dass Hebel sogar fast Pfarrer an der Altstädter Kirche in Pforzheim geworden wäre, ist zwar nicht sicher, aber es spricht vieles dafür. In einem Brief aus dem Jahr 1790 ist die Rede davon, dass der junge Vikar glaubt, eine Pfarrei wegen stimmlicher Probleme nicht annehmen zu können. Hebels Biograf Preuschen vermutete, es handele sich bei dieser Pfarrei um diejenige der Altstadt von Pforzheim, an der sein ehemaliger Kollege Karl Friedrich Sonntag von 1787 bis 1789 tätig war. Sollte Hebel dessen Nachfolger werden?
Wie wir wissen, wurde er es nicht, sondern ging als Subdiakon nach Karlsruhe. In seinen Kalendergeschichten jedoch taucht der Name Pforzheim zweimal im Zusammenhang mit dem Schneiderhandwerk auf – zu Hebels Zeit war der Ruhm der Pforzheimer Tuchherstellung eben noch nicht vergessen. Neben der „Standrede über das glückliche Los des Schneiders“ ist „Der Schneider in Pensa“ eine der bekanntesten Kalendergeschichten Hebels.
Sie thematisiert – ganz im Sinne der „Löblichen Singergesellschaft – etwas buchstäblich „Wunderbares“, nämlich die Kraft eines Menschen zur Barmherzigkeit in einer erbarmungslosen Welt. Für seine Geschichte, die sich tatsächlich nach dem Rußlandfeldzug Napoleons ereignete, an dem auch badische Truppen beteiligt waren, verwendete Hebel Berichte von zurückgekehrten Offizieren. Der Schneidermeister Franz Anton Egetmeier aus Bretten war 1790 nach Pensa, einem Ort 600 km südlich von Moskau ausgewandert. 1812 nahm er 16 badische Kriegsgefangene bei sich auf. In Pensa „welches für sich schon mehr als 100 Tagereisen weit von Lahr oder Pforzheim entfernt ist, und wo die beste teutsche oder englische Uhr, wer eine hat, nimmer recht geht, sondern ein paar Stunden zu spät“, blieben die Kriegsgefangenen gut versorgt bis Ende 1813.
Den Ellmendinger Wein erwähnte Hebel im „Rheinländischen Hausfreund“ von 1812 unter der Überschrift „Des Adjunkts Standrede über das neue Maß und Gewicht“. Diese im Stehen gehaltene Rede diente der Propagierung der Einführung eines neuen einheitlichen Maß- und Gewichtssystems für Baden.
Vielleicht wurden ähnlich wie in Hebels fiktiver Geschichte Bürgerversammlungen abgehalten, um mit volkstümlichen Worten die Vorteile des neuen Dezimalsystems zu erklären: Praktikabilität, Kostenersparnis, Einfachheit, Sicherheit vor Betrügerei, Abbau von Handelshemmnissen, Anschluss an die internationale Tendenz usw. Wie auch immer, die Bürger hatten ein Viertel Wein vor sich stehen. Und der Referent unterbricht seinen Vortrag: „Hausfreund … reicht mir einen Schluck von Eurem Viertelsmeßlein Ellmendinger herauf. Mein Mund ist von der Rede trocken, und Ihr zwingts doch nicht ganz. Denn es ist nicht das erste, das Ihr heute trinkt, auch nicht das zweite.“
Am Beispiel des Viertelmeßleins Ellmendinger, vermutlich war es vom Keulenbuckel, demonstrierte Professor Hebel erstaunlich modern, nämlich handlungsorientiert, die vorteile des neuen Maßsystems: „Fast alles geht jetzt in 10 Teile : 1 Zuber sind 10 Malter, 1 Halter hat 10 Sester, 1 Sester hat 10 Meßlein, 1 Meißlein hat 10 Becher.“
Pädagogische Reformen hatten an Hebels Schule eine lange Tradition. Gestiftet hatte sie Markgraf Ernst Friedrich in Durlach im Jahre 1586. In die neue Residenz nach Karlsruhe verlegt wurde sie 1724, also
9 Jahre nach der Stadtgründung. Vorher allerdings befand sich das Gymnasium illustre in Pforzheim. Philipp Melanchthon war hier Schüler.
Weniger bekannt ist Hebels Verbindung mit dem Drucker und Verleger Christian Friedrich Müller – für hilfreiche Unterstützung bei der Recherche bin ich seinem Ururenkel Christof Müller-Wirth zu Dank verpflichtet. 1797 gründete Christian Friedrich Müller sein Geschäft in Karlsruhe und besorgte die bis heute umfangreichste Ausgabe seiner Werke (1832-1834). 1811 und 1812 druckte und verlegte er zwischenzeitlich auch Hebels „Rheinländischen Hausfreund“. Verheiratet war Christian Friedrich Müller mit Wilhelmine Müller geborene Maisch, die Hebel einmal als Muse „der Nagold und der Enz“ bezeichnete. Man weiß nicht, ob man dem Schriftsteller Peter Härtling glauben soll, demzufolge Wilhelmine eine kurze, aber heftige Affäre mit Hölderlin hatte. Schließlich war niemand dabei. Später publizierte die Dichterin zahlreiche eigene Gedichtbände sowie „Taschenbücher für edle Weiber und Mädchen“ im Verlag ihres Mannes. Wegen seiner Mesalliance, d.h. der nicht standesgemäßen Verbindung bzw. der gesellschaftlichen Achtung seiner Heirat mit einer emanzipierten Dichterin verzog Christian Friedrich Müller für 4 Jahre nach Pforzheim, wo er die Pforzheimer Wöchentlichen Nachrichten, also die, man höre und staune, heute noch bestehende Zeitung gründete. Am 2. März 1802 schrieb der Pforzheimer Zeitungsverleger an den Markgrafen:
„Seit 1 ½ Jahren … wohne ich in Pforzheim, wohin ich, weil seit mehr als 100 Jahren daselbst kein Etablissement der Art sich befand, von einigen Freunden zu ziehen bewogen wurde. Fünf Jahre zuvor, ehe ich dahin zog, wurde für diese Stadt ein kleines Wochenblatt unter der Zensur des dasigen fürstlichen Oberamts auswärts gedruckt, mir aber, als ich mich dahin zu ziehen entschlossen hatte, der Verlag dieses Wochenblatts, von den vorherigen Unternehmern und Redakteurs übertragen.“
In eben diesem Wochenblatt erschien im September 1802 eine Subskriptionsanzeige für Hebels Alemannische Gedichte und 1807 – Müller war mittlerweise wieer in Karlsruhe und „Hofbuch-Drucker“ – in seinem Verlag die Schrift „Dr. Franz Josef Galls neue Entdeckungen in der Gehirn-, Schedel- und Organenlehre“.
Ich komme zum Schluss und zu einem Brief Hebels an seine Freundin Gustave Fecht vom August 1799: „Rechnen Sie etwas auf die Mißlaune, die einen Schulmeister und Eremiten wohl bisweilen befallen kann, und überzeugen Sie sich, dass es nicht so schlimm war, wenn ich Ihnen sage, dass ich in keinem Bade gewesen sey. Man darf sich nur etwas recht fest vornehmen, wenns nicht geschehen soll. Den Tag eh’ ich fortwollte fiel mir ein, ein hoher Berg sei Lieblicher als ein feuchter Badkasten, und reine frische Luft gedeihlicher als warmes Wasser, und stille Beobachtung der ländlichen Menschheit interessanter als ein Gewühl von 400 Badgästen und 20 Gulden weniger, als 60 oder 80. Ich schnallte also den andern Morgen kurz und gut den Mantelsack auf mein Renntier, das sich von den anderen Renntieren darinn unterscheidet, dass wir auf unseren Reisen nebeneinander gehen, dass es statt Moos Weisbrod frisst, und statt Schneewasser Wein sauft, und catholischer Religion ist. Mittags 12 Uhr waren wir auf dem Tobel. Sehn Sie, dass es nicht so arg ist? 6 Stunden in einem Vormittag bergauf, weill etwas sagen. Tobel ist ein hoher Berg hinter Frauenalb, mit einem Wirtembergischen Pfarrdorf, das ein sehr wohl eingerichtetes Wirthshaus hat; auf 3 Seiten dunkler Tannenwald umher, auf der 4ten eine freie Aussicht über den Rhein.
Hier wollte ich alle Morgen von 6-8 Uhr spazieren gehen, dann heim den Caffee trinken und bis 12 Uhr behaglich an den Kirchengebeten arbeiten, lesen, Briefe schreiben, Nachmittags mich dem Zufall und mir selbst überlassen.
Mit der Gesellschaft des Pfarrers und der gebildeten Wirthsleuten, und der ungebildeten Wirthsgäste, hoffte ich auszureichen. Aber wie gesagt, man nehme sich etwas vor!…
Als ich kaum eine Stunde auf dem Tobel war, und … unter dem Fester lag, erblickte ich einen feinen Herrn mit einem Glas am Auge im Hof, und hinter ihm eine feine Dame. „Franz, was hesch guggelet“, fragte sie. „Numme do no der Amsle hani glueget“, antwortete er.
Sie glauben nicht, wie lieblich mir diese bekannten Töne so unerwartet ins Ohr fielen, obgleich der Vogel eine Wachtel war.
Ich dachte Landsleute seid ihr nicht, aber Schweitzer gewiß, und nahezu Berner. So wars auch … Beyde waren so klug wie ich auch, den Aufenthalt auf dem Tobel angenehm und gedeihlich zu finden … Endlich kam das Rennthier wieder, mit dem ich heiter und gesund wie ichs sonst immer war, zurückkehrte, wieder in einem halben Tag auf einmal. Den andern Tag war der Brand in Durlach. Aber wie werd ich Ihnen so langweilig?…
Leben Sie wohl! Ich bin mit der aufrichtigsten Hochachtung Ihr ergebenster und gehorsamster
Doktor Hebel.
Copyright:
Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen, Speicherungen in Datenverarbeitungsanlagen oder Netzwerken, Wiedergabe auf elektronischen, fotomechanischen oder ähnlichen Wegen, Funk oder Vortrag - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Autors.
Nach oben
|
 |
|
Johann Peter Hebel
(1760-1826)
|
 |
|
Das Hebelhuus in Hausen im Wiesenthal
|
 |
J.P. Hebel redigierte von 1809 - 1815 den Karlsruher Almanach-Kalender "Der Rheinländische Hausfreund" Eine Auswahl der Kurzgeschichten, Berichte und Anekdoten erschien 1811 bei Cotta in Tübingen als Buch unter dem Titel "Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes"
|
 |
|
Das Hebel Gymnasium Pforzheim
|
|