|
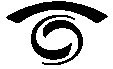 |
||||
|
LÖBLICHE SINGERGESELLSCHAFT
|
|||||
|
Pforzheim und Baden zur Zeit Johannes Reuchlin. Die Auswirkungen markgräflicher Regierung auf die Stadt Vortrag |
|
||||
| „REUCHLIN! Wer will sich ihm vergleichen, Zu seiner Zeit ein Wunderzeichen! Das Fürsten- und das Städtewesen Durchschlängelte sein Lebenslauf.“ Johannes Reuchlin als Wunderzeichen seiner Zeit, das ist sicherlich das Wort, welches den meisten in Erinnerung geblieben ist von Goethes Urteil über den berühmtesten Sohn der Stadt Pforzheim. Im Folgenden soll dagegen der zweite Teil des Zitates unsere Gedanken leiten: „Das Fürsten- und das Städtewesen/Durchschlängelte sein Lebenslauf.“ Wie sah Pforzheim aus, welchen Stellenwert besaß die Stadt im seinerzeitigen Machtgefüge? Welchen Veränderungen war das Verhältnis zwischen Städten und Fürstentümern ausgesetzt? Und schließlich: wie war das Verhältnis Johannes Reuchlins zu seiner Vaterstadt? Wir alle sind geprägt von der Geburtsstadt, von dem Ort, an dem wir aufwuchsen, zur Schule gingen, an dem wir arbeiten und dergleichen mehr. Aber dass ein Leben sich von der Wiege bis zur Bahre an ein und demselben Ort entfaltet, ist sehr selten, wenn nicht gar nahezu unmöglich geworden. Mobilität ist heute angesagt. Das war bei Johannes Reuchlin ähnlich. Auch sein Leben ist geprägt von Umzügen und von Beweglichkeit, nicht nur geistiger. Und dennoch blieb er zeitlebens Pforzheimer: Seine Familiengeschichte ist ein guter Beleg für die Stadtgeschichte des späten Mittelalters. Denn die „Reuchlins“ waren seinerzeit kein lange eingesessenes Geschlecht in Pforzheim, sondern erst in der Generation vor Johannes nach Pforzheim gezogen. Die Familie seines Vaters stammte aus einem kleinen Weiler im Nagoldtal. Die Stadt übte wie Jahrhunderte später zur Zeit der Industrialisierung auch zu Beginn des 15. Jahrhunderts noch eine große Anziehungskraft auf die Bewohner der Region aus. Schließlich war mit dem Stadtbürgertum ein Maß an Rechtssicherheit verbunden, welches auf dem Lande weniger galt. Dennoch machte sich Johannes Reuchlin im zarten Alter von 15 Jahren aus Pforzheim davon, nicht allein um groß zu werden, sondern um gar der „größte Sohn der Stadt zu werden“. Er immatrikulierte zunächst an der Universität in Freiburg, drei Jahre später studierte er in Paris, schließlich in Basel, Orléans und Poitiers, um 1482 in Dienste des württembergischen Hofes zu wechseln und somit nach Stuttgart zu ziehen. Weitere Stationen seines Lebensweges neben den vielen Reisen während seiner Dienste für Württemberg sind der Pfälzische Hof in Heidelberg, später Ingolstadt und Tübingen. Hier ist kein Raum, sich länger mit seiner Biographie zu beschäftigen, doch es kann festgehalten werden: Johannes Reuchlin hat nur die Kindheitsjahre seines Lebens in Pforzheim verbracht. In einem Begleitwort zu diesem Werk preist Reuchlin seine Heimatstadt für ihr reges geistiges Leben: „Dich, Thomas, und daneben die Stadt Pforzheim muss ich für glücklich halten, weil ihr es seid, durch die des Rabanus Werk vom Kreuze prangt.“ Kurzum: wir können zweierlei festhalten: Pforzheim ist für Reuchlin wichtig. Und: Pforzheim war eine bedeutende Stadt zu Reuchlins Zeiten, so dass sein Bekenntnis zur Geburtsstadt nicht ohne Stolz geleistet worden sein muss. Wenden wir uns nun der Stellung der Städte im allgemeinen und Pforzheims im besonderen zu: Neben dem Handel trugen die beiden Kirchen St. Martin und St. Michael zur Bedeutung der Stadt bei 2 . Auch das Dominikanerkloster prägte das Leben Pforzheims im Mittelalter. In unserem Zusammenhang am bedeutendsten ist sicherlich die Lateinschule, die nicht nur unser Jubilar, sondern auch dessen nicht minder berühmte und bedeutende Großneffe, Philipp Melanchthon, besuchte. Die Lateinschule als Ort der höheren Bildung im Mittelalter ist nicht nur für die Biographie Reuchlins bedeutend, sie zeugt auch von den vielen Funktionen und damit von der Bedeutung der Stadt Pforzheims in dieser Zeit. In ihrer äußeren Gestalt wird die Stadt zu Reuchlins Lebzeiten überragt von der markgräflichen Schloßanlage. Um den geräumigen, fast rechteckigen Marktplatz mit dem Brunnen als Mittelpunkt ist die Stadt planmäßig angelegt. In der Nähe des Marktes finden wir neben den Palästen der vornehmen Bürger und des Adelspatriziats, die Klöster der Franziskaner und das Heiliggeistspital. Auch die Lateinschule und die Druckerei Anshelms befanden sich im Stadtkern. Östlich des Marktplatzes im Bereich des Predigerklosters, in dem Reuchlins Vater tätig war, muss sich auch sein Geburtshaus befunden haben, dessen genauer Standort sich aber nicht mehr mit Gewißheit nachweisen läßt. Das eigentlich „Städtische“ findet sich in eben diesem Stadtkern sowie in der Vorstadt „zwischen den Wässern“ Enz und Nagold. Neben diesem vornehmen und repräsentativen Stadtkern gab es einfachere Viertel um die beiden Gerbergassen und im Bereich um die Scheuerngasse [der heutige Bereich der Metzgergasse]. Im Norden der Stadt bauten die Bürger zu Reuchlins Lebzeiten Wein an. Im Süden wurde noch Landwirtschaft betrieben, morgendlich wurde von hier das Vieh auf die Weide außerhalb der Stadt getrieben. Über der Vorstadt Au lag das Heim der „Sondersiechen“, das Georgenstift. Zu erwähnen sind noch die Festplätze: auf dem Lindenplatz fanden beispielsweise Freischießen statt. Um 1500 hatte die Stadt an Enz und Nagold ungefähr 3000 Einwohner und war unter den damals insgesamt 5000 Orten mit Stadtrecht im Reich zwar keine Metropole, aber dennoch eine bedeutendere „große Kleinstadt“ und dennoch die größte Stadt Badens. Köln, die seinerzeit größte Stadt im Reich zählte 35.000 Einwohner, Straßburg 18.000, Basel 8.000 und Heidelberg als kurpfälzische Residenz, an der auch Reuchlin diente, 5.000. Die schon zu Zeiten der Antike als günstig entdeckte geographische Lage hatte im Mittelalter zu einem regen Fernhandel über Pforzheim geführt. Der Grundriß der mittelalterlichen Stadt von mehr als 20 Hektar übertraf den anderer Städte in der Markgrafschaft Baden, nächst größere Stadt war Durlach mit rund 16 Hektar. Im 15. Jahrhundert war Pforzheim nach Süden und Westen hin erweitert worden. Aus folgendem Zitat geht der Wandel der Gestalt Pforzheims hervor: Demnach war die „Alte Stadt“, „die mit dem Mühlgraben an der Enz abschloss, […] ummauert, einschließlich des Ringwalls der Burg und mit sechs Toren versehen. Sie ist bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts als selbständige Altenstadt von den rings sich bildenden Vorstädten getrennt gewesen. Ihr Marktplatz bildete die geometrische Mitte nach allen Seiten. Die erste Erweiterung erfolgte nach Süden in der Vorstadt ‚zwischen den Wassern’ d. h. dem Eichmühlgraben und der Enz, und dann nach Westen in der sogenannten Brötzinger Vorstadt. Beide Vorstädte waren Jahrhunderte lang dünn bebaut und wurden erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts in den Mauergürtel der Stadt einbezogen. Jedoch so, dass zwar der Teil ‚zwischen den Wassern’ mit der Altstadt verschmolz, nicht aber die Brötzinger Vorstadt, die noch bis ins 19. Jahrhundert durch die Mauerführung der Altenstadt von dieser abgesondert war.“ 3 Die berühmteste Beschreibung in Worten wurde von zwei venezianischen Gesandten anno 1492 geschrieben: demnach war Pforzheim eine „Stadt ohne Bischof – eine recht vornehme Stadt, gleichfalls mit Brunnen. Zwei kleine Flüsschen fließen unter ihren Mauern. ... Es gibt hier verschiedene Gewerbe, besonders Uhrmacher, und sehr schöne Paläste. – Die Stadt liegt in einem Tal und an einer Bergwand; auf der letzteren ist ein kleines Kastell, in welchem der Hauptmann der Stadt wohnt.“ 4 Ungefähr zwanzig Jahre nach Reuchlins Tod beschrieb der aus Pommern stammende Bartholomäus Sastrow, der hier als Kanzleischreiber wirkte, die Stadt. Seine Schilderung trifft aber sicher auch noch das Bild zu Reuchlins Lebzeiten und sei hier ebenfalls ausführlicher zitiert, weil sie etwas vom Alltag, zumindest der für die Stadt repräsentativen und sie regierenden Menschen aussagt. Freilich hören wir aus Sastrows Worten auch schon, dass Pforzheim gegenüber Reichsstädten oder Residenzen anderer Fürstentümer sicher keine Metropole war. Das Zitat könnte aber, so es dergleichen schon gegeben hätte, aus einem Reiseprospekt der markgräflichen Tourismusförderung stammen: „Pforzheim ist nicht groß, hat nur eine Kirche und liegt gar im Grunde an einer schönen lustigen Wiese. Dadurch läuft ein klares gesundes Wasser, das allerlei wolschmeckende Fische giebt, daran man des Sommers gar gute Kurzweil haben kann, zwischen überaus hohen Bergen, welche mit Holzungen bewachsen, die einer Wildnis nicht ungleich sind und gutes Wildpret geben. Das fürstliche Schloß liegt zwar an sich niedrig, aber im Vergleich mit der Stadt ziemlich hoch. Sonst hat die Stadt viele gelehrte, bescheidene, freundliche, wolerzogene Leute, und es fehlt ihr nichts von allem, was zur Leibesnotdurft, auch Erhaltung zeitliches Lebens in Gesundheit und Krankheit vonnöten ist, an Gelehrten und Ungelehrten, Apothekern, Balbiren, Wirtshäusern und allerlei Handwerkern. … Die Lebensweise war von der Pommerschen Art sehr verschieden, an Fleisch und Fischen, allerlei Zugemüs, gesottenen Feigen, Haferbrei und mancherlei Kraut. Dazu gab es ziemlich Brot, und ein jeder bekam in einem zinnernen Becher bei anderthalb Stuck Tischwein, womit man, sonderlich des Sommers, lange nicht reichen konnte. Auf der Räthe Tische wurde zweimal eingeschenkt, während die Schreiber sich mit einem geringeren Maße begnügen mußten.“ 5 Wenn das Leben also augenscheinlich so angenehm in Pforzheim war, mußte es andere Gründe geben, weswegen Reuchlin in die Ferne zog: Diese lagen zum einen in der Organisation des Bildungswesens im Späten Mittelalter, zum anderen in den Möglichkeiten, das an den Universitäten erworbene Wissen im „Beruf“ anzuwenden – hier, das sei vorweggenommen, war Reuchlin an die Höfe oder an Universitäten und somit an Residenzen und Universitätsstädte angewiesen. Schließlich aber liegen die Gründe, weshalb Reuchlin seine Wirkung anderswo entfalten sollte, auch in der Geschichte der Stadt im allgemeinen und in der Pforzheims im Besonderen. Wir unterscheiden im Mittelalter zwischen Reichs-, Territorial- und Freien, meist ehemaligen Bischofsstädten. Reichsstädte unterstanden dem Kaiser als Stadtherrn und wurden somit unmittelbar vom Reich regiert, um einen modernen Begriff zu verwenden. Die Reichsunmittelbarkeit konnte zu- aber auch aberkannt werden. Deshalb schwankt die Anzahl der Reichsstädte über die Jahrhunderte. Zu Reuchlins Zeit war sie mit 83 auf dem Wormser Reichstag von 1521 am höchsten. Reichsstädte hatten Privilegien wie etwa das der Hohen Gerichtsbarkeit, wodurch sie den Fürsten des Reiches gleich gestellt waren. Vor allem Sitz und Stimme auf den Reichstagen sicherte Städten wie Heilbronn, Offenburg oder Speyer, um nur wenige aus der Region zu nennen, großen Einfluss auf die Geschicke des Reiches. Aber sie hatten auch Pflichten gegenüber dem Kaiser. Hierzu gehörten vor allem die Steuerpflicht und als noch stärker in das Leben der Stadtbewohner eingreifende Pflicht die der Heerfolge. Neben den Reichsstädten gab es die „Freien“ Städte, die ursprünglich unter der Herrschaft eines Fürsten oder eines Bischofs gestanden hatten, sich aber mehr und mehr Freiheiten erkämpften. So verschmolzen die Begriffe zur Bezeichnung „Freie Reichsstadt“. Die Territorialstädte schließlich unterstanden nicht dem Kaiser, sondern dem jeweiligen Territorialherrn. Sie konnten über ein unterschiedlich großes Maß an Autonomie verfügen, welches abhängig war von Stärke und Handeln des Bürgermeisters und Rates, vom Umfang des Friedens-, Rechts- und Gerichtsbezirks der Stadt, der Ausprägung eigener Behörden, der Vertretung der Stadt auf Land- oder Reichstagen und anderen Faktoren. Pforzheim war nie eine freie Reichsstadt, es war eine Fürstenschöpfung und blieb eine Fürstenstadt „mit all den Vorzügen und Nachteilen einer solchen“ 6 . Seit 1219 war die Stadt an Enz und Nagold markgräflich. Innerhalb der Markgrafschaft Baden hatte Pforzheim sogar bis zum Ausgang des Mittelalters eine herausragende Stellung als wichtigster Stützpunkt der Markgrafen. Wenn wir von der Bedeutung Pforzheims für die Markgrafschaft zu Reuchlins Zeiten reden, sollten wir allerdings nicht vergessen, dass seinerzeit außer Pforzheim Durlach und allenfalls noch Ettlingen nennenswerte Städte Badens waren. Zu den Vorzügen gegenüber freien Städten zählte die Vielfalt der in den Stadtmauern ansässigen Stände und Berufe, die ein gewisses Maß an Eigenständigkeit garantierte und die Sastrow anschaulich beschrieben hat. Auch gewährten die häufige Anwesenheit des Fürsten sowie die zahlreichen Adelssitze der Stadt Sicherheit. Pforzheim war also nicht nur, und gar nicht in erster Linie eine Stadt der Bildung, wie die Lateinschule und die Klöster nahelegen könnten. In ihr wohnte ein stolzer Stadtadel und eine sich kräftig regende Bürgerschaft. 7 Obwohl sich der Markgraf häufig in Pforzheim aufhielt, die Stadt mithin Residenzfunktionen hatte, hielt sich der markgräfliche Besitz innerhalb der Stadt noch bis zur Reformation in Grenzen: selbstverständlich das alles überragende Schloß, daneben allerdings nur noch die Bleichwies, „am Metzelgraben“ gelegen und die Altenstädter Kelter. Dennoch waren die Auswirkungen markgräflichen Besitzes auf die Stadt und ihre Umgebung nicht gering zu schätzen: So mußten die Untertanen des Frauenklosters in Brötzingen, Eutingen und Ispringen das Schloß mit dem nötigen Brennholz versorgen. Die Einwohner Büchenbronns und Huchenfelds waren angewiesen, die markgräflichen Wiesen zu mähen und zu heuen, die Brötzinger wiederum sollten das Heu in den Marstall bringen. Versteht sich, dass die Früchte der Wingerter um Pforzheim an die fürstliche Kelter abgegeben wurden 8. Demnach wogen die Rechte, die der Markgraf in der Stadt wahrnahm, größer als sein materieller Besitz. Der Markgraf zu Baden war „rechter Herr zu Pfortzheim und hatt daselbst und so wyt der Statt Zwing, Zehnd und Bann get allein den Stab, auch das Geleit und alle Obrigkeit, Herrlichkeit, Gebott, Verbott, Hoch und nider Gericht, Frevel, Strafen und Bußen“. Will heißen: Steuern („Zehnd“) gingen ebenso an den Landesherrn wie Zölle, das Standgeld für Jahrmärkte auf Pforzheimer Gemarkung oder die Zinsen für Betriebe. So gab es einen Metzelbankzins, einen Brothüttenzins, einen Brotbank- und einen Fischbankzins. Steuern auf Wein, Früchte und Fleisch sowie Mühlenerzeugnisse gingen ebenso in den Säckel des Markgrafen. Auch die Einnahmen, die aus Strafen gegen Friedensbrüche vor dem städtischen Gericht verhandelt worden waren, kamen ihm zugute9. Die berühmte „Fürstenhochzeit“ 1447 zwischen dem späteren badischen Markgrafen Karl I., seinerzeit noch Erbprinz, und der Herzogin Katharina von Österreich zeugt von der noch innigen Verbindung zwischen dem Markgrafen und Pforzheim und belegt, dass die Stadt innerhalb der Markgrafschaft die geräumigste und wichtigste Badens war. Wo sonst hätten all die illustren Gäste und Spielleute Platz gefunden? Immerhin war neben den Örtlichkeiten der Vermählung Platz für ein Reiterturnier mit 6000 Pferden. Schließlich mußten irgendwo die 100 Ochsen, 1500 Kälber, 8000 Gänse, 17.000 Hühner und ungezählte Tauben zum Verzehr gerichtet werden. Die Fürstenhochzeit in Pforzheim war eines der größten Feste, die hier jemals gefeiert wurden und somit auch ein Höhepunkt in der Stadtgeschichte – Höhepunkt aber leider auch in dem Sinne, dass ein Entwicklungsstand erreicht war, von dem es hernach „bergab“ ging: In der Folgezeit, somit schon zu Lebzeiten Reuchlins ging die Bedeutung der Stadt zurück. Schon die Regentschaft Karls I., des Bräutigams war für Pforzheim ambivalent: einerseits setzte seine Hochzeit in Pforzheim ein Zeichen von der Bedeutung der Stadt. Auch die von Karl in Angriff genommene Gründung einer Universität hätte Pforzheim begünstigt. Andererseits wurden viele dieser Pläne während Karls Zeit zunichte: die Supplik an Papst Pius II., in Pforzheim eine Universität errichten zu dürfen, war schon positiv von diesem beantwortet worden. Mit der Umwandlung der Ettlinger und Pforzheimer Pfarrkirchen in Kollegiatstifte 1460 war die Finanzierung bereits angegangen. Doch es sollte anders kommen: Gleichzeitig nämlich verfolgte Karl eine Fehde mit Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Die resultierende Schlacht bei Seckenheim am 30. Juni 1460 ging für den badischen Markgrafen und seine Verbündeten aus Württemberg und Metz verheerend aus: nicht nur, dass Karl selbst in einjährige Haft geriet, die er in Heidelberg absitzen mußte. Er mußte darüber hinaus schmerzhafte Zugeständnisse an den kurpfälzischen Hof machen: Im Jahr 1463 kaufte sich Karl mit 100.000 Gulden aus der Haft frei. Pforzheim wurde bis zum Jahr 1750 zu einem pfälzischen Lehen. An eine kostspielige Universitätsgründung war nicht mehr zu denken. Zum einen fehlten hierfür nun die Mittel, zum anderen hätte der Pfalzgraf als Lehensherr von Pforzheim kaum einer Konkurrenzgründung so nahe an der bestehenden Universität Heidelberg zugestimmt. So gründete der einstige Verbündete Karls, Eberhart im Barte, im württembergischen Tübingen seine eigene Hochschule. Und so kommt es, dass Reuchlin dort und nicht in seiner Geburtsstadt studieren sollte. Pforzheims Jubilar des Jahres 2005 jedenfalls mag im zarten Alter von sieben Jahren vielleicht etwas von den kriegerischen Auseinandersetzungen, die auch in der Nähe von Pforzheim geführt worden waren, mitbekommen haben – 1462 verwüsteten pfälzische Truppen die Dörfer im Remchinger Tal. Von den langfristigen Konsequenzen, die schließlich auch sein Leben in andere Bahnen hätte lenken können, indem er vielleicht in seiner Geburtsstadt hätte studieren können, wird er noch nichts gewußt haben. Zu Reuchlins Lebzeiten wurden von Seiten des Markgrafen aber auch durchaus Weichen gestellt, die das Wohlergehen des städtischen Gemeinwesens stärken sollten. Karls Nachfolger Markgraf Christoph I., der infolge der Kriegspolitik seines Vaters kein leichtes Erbe anzutreten hatte und klamme Kassen vorfand, erkannte die Zeichen der Zeit und versuchte, sein Territorium durch „Wirtschaftsförderung“ wieder nach vorne zu bringen. Er erkannte, dass nur das Städtewesen der Ausübung von Gewerben förderlich war und versuchte folgerichtig Städte und Gewerbe gemeinsam zu unterstützen. Der Salzverkauf beispielsweise war von jeher Privileg der Stadt. Im Jahr 1497 verkaufte Christoph den Bürgern Pforzheims seine Walkmühle, wodurch das Wollgewerbe in der Stadt einen Aufschwung erleben konnte. Wegen der Viehtreiber im benachbarten württembergischen Umland und der Heimsheimer Schäfereien war Pforzheim hierzu prädestiniert. Dass die Stadt neben dem Murgtal ein Zentrum der Holzwirtschaft war, ist Ihnen allen bekannt, noch bis zum Beginn des vorigen Jahrhunderts berief man sich gerne auf die stolze Tradition der Flößer. Durch einen Münzvertrag mit Württemberg erleichterte Christoph obendrein den Wirtschaftsverkehr mit den östlichen Nachbarn, was für Pforzheim als Stadt am Rande Badens ungeheure Vorteile brachte. Als jemand, der die Bedeutung der Gewerbeförderung erkannt hatte, war Christoph also gleichzeitig Förderer der Stadtwirtschaft. Seine gesetzgeberische Tätigkeit war insofern zukunftsweisend, als er zahlreiche Ordnungen erließ. Heute beklagen Wirtschaftsführer die Überreglementierung durch den Staat, seinerzeit schufen die Ordnungen für Flößer, für Goldschmiede, für Tucher und für Bäcker – allesamt von Christoph I. erlassen – erst die Grundlagen für ein geregeltes und gedeihliches Wirtschaftsleben. Vielleicht wird Christoph etwas unterschätzt, wenn man ihm nachsagt, er wäre „ein Organisator im beschränkten Rahmen seines Territoriums [gewesen], der vermöge seiner Stellung wie seiner Begabung den Erscheinungen seiner Zeit sein Herz öffnete, ohne seiner gedanklich im Mittelalter verwurzelten Stellung untreu zu werden.“ 10 Manche von Christophs Handlungen, die sich auch auf die Stadt Pforzheim auswirkten, waren nämlich durchaus zukunftsweisend, insbesondere die Stadtfreiheiten für Pforzheim und Baden. In Stadtfreiheiten oder „Privilegien“ befreiten die Stadtherren die Städte von Fesseln, die ihnen ältere Verträge oder Gewohnheitsrecht auferlegt hatten, und definierten gleichzeitig die Rechte der Städte neu. Die „Freiheiten der Stadt Pforzheim“, 1491 von Christoph erlassen und uns heute nur durch ein „Vidimus“, eine Kopie eines Schreibers von 1517 erhalten, wurden lange Zeit als Beleg für die Fürsorge des Markgrafen für Pforzheim interpretiert. In ihnen erkannte man über Jahrhunderte die Grundlegung wirtschaftlichen Wohlergehens der Stadt. Dagegen ist diese Interpretation heute einer differenzierteren Sicht gewichen. Zum ersten machte der Markgraf die Stadt und ihre Einwohner frei, und zwar frei von aller „bette, schazung, sture, frondienste, landtschadens, furung und aller beswernis, nicht ußgenomen, in kunftigen zytten und tagen ewiglich ganz fry, ledig, unbekumbert und ungetrengt“. Die Stadtbewohner Pforzheims waren insofern frei, als sie nun aus der Stadt ziehen konnten. Freilich hat man sich den Wegzug nicht so einfach vorzustellen. Auch zu Reuchlins Zeiten waren damit Formalien, konkret die Abmeldung beim Schultheißen (als oberstem Beamten des Markgrafen) und beim Bürgermeister der Stadt verbunden. Vor allem aber war der dauerhafte Wegzug aus der Stadt mit Kosten verbunden: bis zu zehn Prozent des Vermögens, das sie aus der Stadt mitnahmen, mußten die ausreisewilligen Bürger bezahlen. Auch die Befreiung von direkten Steuern wurde anderswo kompensiert, indem der Markgraf nun in verstärktem Maße Verbrauchssteuern erhob. Durch die „Steuerentlastung“ bei der direkten Steuer sollten Handwerker in die Stadt gelockt werden. Und dies, nicht etwa ein in die Zukunft weisendes Interesse des Markgrafen an der Freiheit der Untertanen, war ein wichtiger Beweggrund für den Erlaß der Ordnung gewesen: Ganz offen heißt es nämlich in der Präambel der Stadtfreiheit, dass hierdurch die „inwonere ouch an eren und gutt zunemen und andere von usswendigen orten dest me gereitzt und hin zu ziehen begirig werden mögen“. Durch die Stadtfreiheiten sollte Pforzheim also wieder attraktiver werden und Handwerker anlocken. Offensichtlich war die Anziehungskraft auf die Umwohner, die im Zusammenhang mit Reuchlins Eltern erwähnt worden ist, im 15. Jahrhundert zurück gegangen. So heißt es ebenfalls in der Präambel der Stadtordnung, Pforzheim habe für den Handel zwar die beste Lage in der Markgrafschaft, sie sei aber bislang „mehr zu abgang dann zu ufgang gericht“ gewesen. Letzteres, also der „Aufgang“, sprich: der Zuwachs solle durch die Stadtfreiheiten wieder gemehrt werden. Tatsächlich hatte Pforzheim unter der Politik von Christophs Vorgängern gelitten, die es nicht vermocht hatten, eine einstmals führende Stellung im südwestdeutschen Raum zu halten und somit auch die Entwicklungsfähigkeit der Städte in Baden hemmten. Aber auch die Freiheiten Christophs I. sollten nicht mehr ausreichen, den Bedeutungsverlust der Stadt aufzuhalten. Man muss die Freiheiten nicht so kritisch bewerten wie Jolande Goldberg, die in ihnen eine Bevormundung sah und die es Pforzheim zugute hielt, es trotz der Stadtordnung von 1491 überhaupt so weit gebracht zu haben11 . Aber die aus Pforzheim stammende US-amerikanische Juristin hat insofern recht, als sie die Stadtordnung nicht allein als Beleg „markgräflicher Mild- und Liebewaltung über Pforzheims Einwohner“ interpretiert. Der kritischeren Einschätzung schloß sich die jüngere Forschung an. So geht es in den Stadtordnungen eben nicht nur um die Förderung des Wirtschaftslebens in der Stadt, sondern auch um die Reglementierung und Lenkung des Verhaltens der Einwohner. Und hier weist die Stadtordnung Pforzheims in die Zukunft: in ihr lassen sich erste Züge einer künftigen Herrschaftsidee erkennen. Sie ist demnach nicht mehr ein vom Reich vermitteltes feudales Privateigentum der Stände und Körperschaften, sondern vielmehr ein „Amt der Fürsten“, mit Rechten und Pflichten auf beiden Seiten. In der Stadtordnung von 1491 finden wir sehr früh dieses Selbstverständnis eines Landesherrn formuliert. Der Garantie der Freiheit von bestimmten Abgaben steht die „habeas corpus-Garantie“ gegenüber, das heißt die Gewährleistung der körperlichen Unversehrtheit oder vielmehr die Verrechtlichung von bisher in Fehden ausgefochtenen Konflikten in einem Landfrieden, den der Markgraf durchzusetzen hatte. Wir können hinter der Stadtordnung deshalb auch die Notwendigkeit erkennen, einen ordentlichen Zustand wieder einzuführen. So verwundert auch wenig, dass in der vorläufigen Pforzheimer Stadtordnung von 1486 erstmals der Begriff der „Polizei“ auftaucht, und zwar in seiner frühneuzeitlichen Bedeutung einer guten Verfaßtheit des Gemeinwesens. Goldberg beschreibt mit blumigen Worten den Hintergrund, vor dem sich Christoph genötigt sah, seine Ordnungen zu erlassen: „Es sind nicht nur die Fehden der Oberen; die bösen Händel, Aufläufe, Raufereien und Geschrei setzen sich auf der Straße fort, das ‚Langmesser’ … blitzte im Ärmel des unterdrückten Bauern und in der Kutte von Geistlichen. Und da sind die Ströme von Flüchtlingen den Truppen voraus, und die Entwurzelten im Gefolge entlassener Söldner auf dem Marsch von einem Theatrum zum andern. Da sind die Flüchtigen vor einer Seuche, einem Brand, einem Stern, und solche auf der Spurfolge einer Weissagung, einer Verheißung; und wandernde Handwerker, und die Händler, Tändler, Spielleut, Huren, Kesselflicker, Juden und Bettler, die den Märkten, irgendeinem ziehenden Hof und dem Reichstag von Ort zu Ort folgen. Es sind aber nicht nur einzelne soziale Gruppen, oder Gruppen am Rande der Gesellschaft: es ist die Gesellschaft selbst, die im allgemeinen Chaos im Reich in Bewegung geraten ist, aggressiv, abergläubisch und verroht. Da ist keine starke Hand von oben, um alle Einzelkräfte zu binden.“ Dies Zitat mag genügen, den Hintergrund zu beschreiben, vor dem die Stadtfreiheiten erlassen wurden und der vielleicht in der Beschäftigung mit der hehren idealistischen Welt Johannes Reuchlins in Hintergrund geraten mag. Sein neues, in die Zukunft weisendes Prinzip der Herrschaftsausübung, das den eben beschriebenen Umständen beikommen sollte, formuliert der Markgraf vier Jahre nach dem Erlass der Stadtfreiheiten Pforzheims deutlicher, nämlich in der Landordnung von 1495, in der die Förderung des „gemeinen Nutzens“ als Absicht ausgedrückt wird. Mit der Formel des „gemeinen Nutzens“ oder des Allgemeinwohls sollten später in einer Generalklausel den absolutistischen Herrschern tiefe Einschnitte in das Leben der Menschen ermöglicht werden. Goldberg liegt sicher falsch, wenn sie Christoph I. bereits als Vorgänger der absolutistischen Herrscher stempelt oder gar in der Markgrafschaft Baden zu Christophs Zeiten einen frühen Polizeistaat sieht. Richtig aber ist ihre Beobachtung, dass entgegen der Ansicht der älteren Forschungsliteratur Christoph sich nicht allein um das Wohl der von ihm geliebten Stadt Pforzheim gesorgt hat, sondern sich mit der Stadtordnung ein Mittel geschaffen hatte, Entwicklungen in die richtige Bahn zu lenken. Und so weist Goldberg auch völlig zu Recht auf die mit den Freiheiten verbundenen Risiken hin, nämlich auf „kleine, mausige, unregelmäßige Löcher im eben erst angelegten Freiheitswämslein genau an der Stelle, wo es des Untertanen empfindlichste Stelle bedeckt: den Beutel. Und obendrauf verpflichtet Artikel 9 die Stadt und Einwohner, gesamtschuldnerisch als Bürgen zu haften, wenn immer der Fürst Schulden macht!“12 Schließlich und endlich aber verhinderte die Stadtordnung, die im übrigen Vorbild für Ordnungen weiterer Städte in der Markgrafschaft war, auch die Entwicklung eines politischen Eigenlebens der Kommunen. Vom Landesherrn unabhängige Haltungen oder gar Städtebunde waren in Baden kaum möglich. Hier war allein die straffer durchorganisierte Verwaltung des Territorialstaats vor – aber auch die war notwendig, um ein Auseinanderbrechen des vergrößerten Territoriums unter Christoph zu vermeiden. Bislang wurden hier die praktischen Seiten des Markgrafen Christoph, dessen Regierungs- und Lebenszeit sich ungefähr mit den Lebensdaten Reuchlins deckt, betrachtet und dabei festgestellt, dass er die politischen Erfordernisse der Zeit durchaus erkannt hat. Hierzu gehört auch seine überaus geschickte Außenpolitik, mit der ihm nicht nur ein Ausgleich mit den Nachbarn gelang, sondern durch die er auch das von ihm beherrschte Territorium verdoppeln konnte. Er hatte aber auch eine andere Seite: so stand Markgraf Christoph „durch seine Bildung auf der Speyrer Domschule und auf der Freiburger Universität wissenschaftlich befähigt, […] den Bildungsbestrebungen seiner Zeit, die besonders im Oberrheingebiet ein lebhaftes geistiges Leben blühen ließen“ nicht fern. Und doch konnte er nicht die Voraussetzungen schaffen, die Reuchlin möglicherweise Wirkungsstätten in Baden hätten schaffen können. Christophs „Natur war zu praktisch eingestellt, als dass er sich zu einem Humanistenmäzen hätte entwickeln können“13 , wenngleich er zeitlebens Beziehungen zu Humanisten pflegen sollte. So nahm Johannes Reuchlin die Gelegenheiten wahr, die ihm andere Territorialherren gaben: seine Reise nach Paris im Jahr 1473 war noch vom badischen Markgrafen Friedrich ermöglicht worden; hernach aber reiste er mit Graf Eberhard von Württemberg nach Italien, und verblieb in württembergischen Diensten, bis ihn die Wirren nach Eberhards Tod veranlaßten, nach Heidelberg zu flüchten. Von dort kehrte er später wieder nach Stuttgart zurück. Dass Johannes Reuchlin phorcensis nicht in seiner Geburtsstadt tätig werden konnte, lag an den territorialpolitischen Konstellationen, die sich zum einen ungünstig auf das Schicksal der Städte in Baden auswirkten, zum anderen den badischen Markgrafen zu einer Politik zwangen, die mehr der Erweiterung des Territoriums nach außen und der Stabilisierung desselben nach innen gewidmet war als der Förderung der neuen Geistesentwicklungen. Am Ende seines aktiven Lebens – er wurde 1516 auf Betreiben seines Sohnes entmündigt, weil angeblich seine „Blödigkeit“ sowie das Nachlassen seiner „vernunft und schicklichkeit, damit er begabt gewesen“ dem Lande hätte schaden können. Noch acht Jahre dämmerte Christoph auf Schloß Baden in geistiger Umnachtung dahin, bis ihn der Tod am 19. März 1527 erlöste. Das Gespenst der Teilung Badens, das sich schon durch die Aufteilung unter seinen Söhnen abgezeichnet hatte, verdichtete sich zur bitteren Realität im August 1535, als aus der Markgrafschaft zwei wurden. Hierdurch verlor Pforzheim weiter an Bedeutung. Hatte sich das machtpolitische Gewicht schon im Verlauf der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts selbst im reichsweiten Durchschnitt zuungunsten der Städte verschoben, so war die folgende Entwicklung für Pforzheim katastrophal: das Pforzheim, wie es uns Sastrow geschildert hat und wie es der Heimatforscher Oskar Trost später beschrieb, nämlich als eine „blühende Gemeinschaft, in der ein hoher Wohlstand herrschte und ein frisches geistiges und gesellschaftliches Leben pulsierte“14 litt durch die Verlegung der Residenz und später durch den 30jährigen Krieg so sehr, dass es nicht mehr Mittelpunkt der Region war, sondern „ein bitterarmes Landstädtchen …, dessen Bewohner hart um das tägliche Brot kämpfen mußten.“ 15 1 Hans Rupprich: Johannes Reuchlin und seine Bedeutung im europäischen Humanismus. In: Johannes Reuchlin 1455-1522. Festgabe seiner Vaterstadt Pforzheim zur 500. Wiederkehr seines Geburtstages. Hrsg. v. Manfred Krebs. Pforzheim 1955, 10-34, hier 332 Stefan Pätzold: Von der Pfarre wegen zu Pforzheim“. St. Martin und St. Michael im Mittelalter. In: Ders. (Hg.): Neues aus Pforzheims Mittelalter. (Materialien zur Stadtgeschichte. Band 19). Heidelberg/Ubstadt-Weiher/Basel 2004, 57-86. 3 Stefan Pätzold: Von der Pfarre wegen zu Pforzheim“. St. Martin und St. Michael im Mittelalter. In: Ders. (Hg.): Neues aus Pforzheims Mittelalter. (Materialien zur Stadtgeschichte. Band 19). Heidelberg/Ubstadt-Weiher/Basel 2004, 57-86. 4 Henry Simonsfeld: Ein venetianischer Reisebericht über Süddeutschland, die Ostschweiz und Oberitalien aus dem Jahre 1492. In: Zeitschrift für Kulturgeschichte N. F. 4 (1897), 241-283, hier 263f. Zur bildlichen Darstellung Pforzheims im Mittelalter vgl. http://www.loebliche-singer-pforzheim.de/VortragPaetzoldStadtimBild2004.html. 5 Grote, Ludwig: Bartholomäus Sastrow, ein merkwürdiger Lebenslauf des sechszehnten Jahrhunderts. Halle 1860, 142f. 6 Henry Simonsfeld: Ein venetianischer Reisebericht über Süddeutschland, die Ostschweiz und Oberitalien aus dem Jahre 1492. In: Zeitschrift für Kulturgeschichte N. F. 4 (1897), 241-283, hier 263f. Zur bildlichen Darstellung Pforzheims im Mittelalter vgl. http://www.loebliche-singer-pforzheim.de/VortragPaetzoldStadtimBild2004.html. 7 Grote, Ludwig: Bartholomäus Sastrow, ein merkwürdiger Lebenslauf des sechszehnten Jahrhunderts. Halle 1860, 142f. 8 Erwin Ohnemus: Der herrschaftliche Besitz des Hauses Baden-Durlach und seine Recht auf Pforzheimer Gemarkung. In: Pforzheimer Geschichtsblätter 1 (1961), 187-193, hier 187. 9 Erwin Ohnemus: Der herrschaftliche Besitz des Hauses Baden-Durlach und seine Recht auf Pforzheimer Gemarkung. In: Pforzheimer Geschichtsblätter 1 (1961), 187-193, hier 191. 10 Wielandt, Friedrich: Markgraf Christoph I. von Baden und die badischen Territorien. In: Zeitschr. für d. Geschichte d. Oberrheins. 85 (1933). S. 527-611, hier 606. 11 Goldberg, Jolande E.: Die Freiheiten der Stadt Pforzheim 1491. In: Pforzheimer Geschichtsblätter. 5 (1980). S. 83-116, hier 84. 12 Goldberg, Jolande E.: Die Freiheiten der Stadt Pforzheim 1491. In: Pforzheimer Geschichtsblätter. 5 (1980). S. 83-116, hier 86. 13 Wielandt, Friedrich: Markgraf Christoph I. von Baden und die badischen Territorien. In: Zeitschr. für d. Geschichte d. Oberrheins. 85 (1933). S. 527-611. 14 Oskar Trost: Die Adelssitze im alten Pforzheim. In: Pforzheimer Geschichtsblätter 1 (1961), 82-145, hier 88.
Gothein, Eberhard: Die badischen Markgrafschaften im 16. Jahrhundert. Heidelberg 1910. (Neujahrsblätter d. Badischen Historischen Kommission. N.F. 13.) Fitzler, H.: Beschreibung Pforzheims aus dem Jahre 1492. In: Pforzheim spricht zu Dir. 1937. Goldberg, Jolande E.: Die Freiheiten der Stadt Pforzheim 1491. In: Pforzheimer Geschichtsblätter 5 (1980). S. 83-116. Haselier, Günther: Die Markgrafen von Baden und ihre Städte. In: Zeitschr. für d. Geschichte d. Oberrheins. 107 (1959). S. 263-290. Krimm, Konrad: Baden und Habsburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts. Fürstlicher Dienst und Reichsgewalt im späten Mittelalter. Stuttgart 1977. (Veröff. d. Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg. B. Bd. 89.) Müller, Ernst: Pforzheim bis 1600. In: Schwäbische Heimat. 11 (1960). S. 185-193. Stefan Pätzold: Die Pforzheimer Stadtansichten des Georg Gadner (1594) und des Matthäus Merian (1643). In: Ängste und Auswege. Bilder aus Umbruchszeiten in Pforzheim. Hg. von der Löblichen Singergesellschaft. Heidelberg/Ubstadt-Weiher/Basel 2005, 53-56. Ders.: „Von der Pfarre wegen zu Pforzheim“. St. Martin und St. Michael im Mittelalter. In: Ders. (Hg.): Neues aus Pforzheims Mittelalter. (Materialien zur Stadtgeschichte. Band 19). Heidelberg/Ubstadt-Weiher/Basel 2004, 57-86. Schulze, Olaf: Krieg, Hunger und Pest - Die Zeit um 1500. In: Pforzheim zur Zeit der Pest - Die Löbliche Singergesellschaft von 1501. Begleitband zur Ausstellung im Museumsareal Pforzheim/Brötzingen. O. O., o. J. [Pforzheim 1993]. 285 S. Abb. S.8-27. Ders.: „... eine recht vornehme Stadet“ und ihre Kehrseiten. Stadt und Umwelt. In: Pforzheim zur Zeit der Pest - Die Löbliche Singergesellschaft von 1501. Begleitband zur Ausstellung im Museumsareal Pforzheim/Brötzingen. O. O., o. J. [Pforzheim 1993]. 285 S. Abb. S. 52-73. Sexauer, Ottmar: Pforzheim zur Zeit Reuchlins. Mit einer topograph. Ergänzung. Mitgeteilt u. erläutert von Erich Rummel. In: Johannes Reuchlin 1455-1522. Festgabe seiner Vaterstadt Pforzheim zur 500. Wiederkehr seines Geburtstages. Hrsg. v. Manfred Krebs. Pforzheim 1955. S. 156-172. Auch in: Johannes Reuchlin (1455-1522). Nachdruck der 1955 von Manfred Krebs herausgegebenen Festgabe. Neu herausgegeben und erweitert von Hermann Kling und Stefan Rhein. Sigmaringen 1994. (Pforzheimer Reuchlinschriften. Bad. 4.). S. 156-172. Stenzel, Rüdiger: Die Städte der Markgrafen von Baden. In: Jürgen Treffeisen, Kurt Andermann (Hrsg.): Landesherrliche Städte in Südwestdeutschland. Sigmaringen 1994. S. 89-130. (Oberrheinische Studien. Bd. 12.) Sütterlin, Berthold: Geschichte Badens. Bd. 1: Frühzeit und Mittelalter. 2. Aufl. Karlsruhe 1968. Timm, Christoph: Pforzheim um 1500 - Zur Topographie einer verschwundenen Stadt. In: Pforzheim zur Zeit der Pest - Die Löbliche Singergesellschaft von 1501. Begleitband zur Ausstellung im Museumsareal Pforzheim/Brötzingen. O. O., o. J. [Pforzheim 1993]. 285 S. Abb. S. 28-51. Wielandt, Friedrich: Markgraf Christoph I. von Baden und die badischen Territorien. In: Zeitschr. für d. Geschichte d. Oberrheins. 85 (1933). S. 527-611. Copyright: |
|